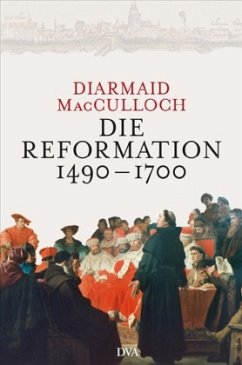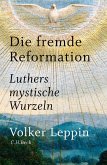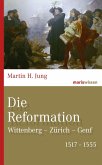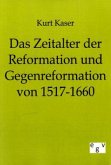Das Standardwerk zur Geschichte der Reformation
Gelehrt und erzählerisch leicht führt der Kirchenhistoriker Diarmaid MacCulloch in diesem großen, mehrfach ausgezeichneten Werk durch die revolutionäre Epoche der Reformation. Über die Ereignisse in den einzelnen Ländern hinweg entwirft er eine faszinierende Gesamtschau der politischen, sozialen und mentalitätsgeschichtlichen Prozesse auf dem ganzen europäischen Kontinent. Er beschreibt anschaulich, wie die verschiedensten historischen Ereignisse an den Rändern Europas auf die zentralen Reformationsgeschehnisse einwirkten und wie umgekehrt diese wiederum weitreichende Wirkungen auf das europäische Staatengefüge hatten. Im ersten Teil des Buches nimmt MacCulloch die Reformatoren, ihre Lehren und ihre Gegenspieler in den Blick, während er im zweiten Teil die realpolitischen Folgen der Reformation und Gegenreformation untersucht. Die religiösen, politischen und sozialen Umwälzungen des reformatorischen Zeitalters beendeten das Mittelalter, bereiteten den Weg in die Neuzeit und gaben Europa ein neues Gesicht.
- Die erste historische Gesamtdarstellung der Reformation in Europa
- Internationale Auszeichnungen für "Die Reformation": Gewinner des Wolfson-Preises für herausragende Geschichtsschreibung 2003, des Preises der Britischen Akademie 2004 und des Sachbuch-Preises des "National Book Critics Circle" der USA 2005
"Ein souveräner Geschichtsschreiber entwirft faktenreich und anschaulich ein groß angelegtes Panorama der Zeit von 1500 bis 1700. Was herauskommt, ist Nachhilfeunterricht für die Deutschen, die an der Spaltung des europäischen Hauses nicht ganz unbeteiligt waren. MacCulloch schreibt genau und lebendig zugleich, mit Sinn für Stil und Witz. Ein außerordentliches Buch, stoffreich, elegant und nachdenklich." Prof. Dr. Kurt Flasch
Gelehrt und erzählerisch leicht führt der Kirchenhistoriker Diarmaid MacCulloch in diesem großen, mehrfach ausgezeichneten Werk durch die revolutionäre Epoche der Reformation. Über die Ereignisse in den einzelnen Ländern hinweg entwirft er eine faszinierende Gesamtschau der politischen, sozialen und mentalitätsgeschichtlichen Prozesse auf dem ganzen europäischen Kontinent. Er beschreibt anschaulich, wie die verschiedensten historischen Ereignisse an den Rändern Europas auf die zentralen Reformationsgeschehnisse einwirkten und wie umgekehrt diese wiederum weitreichende Wirkungen auf das europäische Staatengefüge hatten. Im ersten Teil des Buches nimmt MacCulloch die Reformatoren, ihre Lehren und ihre Gegenspieler in den Blick, während er im zweiten Teil die realpolitischen Folgen der Reformation und Gegenreformation untersucht. Die religiösen, politischen und sozialen Umwälzungen des reformatorischen Zeitalters beendeten das Mittelalter, bereiteten den Weg in die Neuzeit und gaben Europa ein neues Gesicht.
- Die erste historische Gesamtdarstellung der Reformation in Europa
- Internationale Auszeichnungen für "Die Reformation": Gewinner des Wolfson-Preises für herausragende Geschichtsschreibung 2003, des Preises der Britischen Akademie 2004 und des Sachbuch-Preises des "National Book Critics Circle" der USA 2005
"Ein souveräner Geschichtsschreiber entwirft faktenreich und anschaulich ein groß angelegtes Panorama der Zeit von 1500 bis 1700. Was herauskommt, ist Nachhilfeunterricht für die Deutschen, die an der Spaltung des europäischen Hauses nicht ganz unbeteiligt waren. MacCulloch schreibt genau und lebendig zugleich, mit Sinn für Stil und Witz. Ein außerordentliches Buch, stoffreich, elegant und nachdenklich." Prof. Dr. Kurt Flasch

Als es noch ohne die Bibel ging: Diarmaid MacCulloch rollt die Reformation neu auf / Von Eberhard Straub
Im Christentum stand bis in das 15. Jahrhundert hinein nicht das Heilige Buch, die Bibel, im Mittelpunkt. Entscheidend war die Tatsache, dass Gott Mensch geworden war, in die Welt als Geschichte eintrat, um sie und alle Menschen zu erlösen. Dieses historische Ereignis gab dem Buch, dem Alten Testament, der Geschichte Gottes mit seinem Volk, einen ganz neuen Sinn, weil sie durch Jesus als den Christus zur Geschichte Gottes mit der Menschheit wurde. Das weitere Buch, das Neue Testament, die Predigt Jesu und deren Verkündigung durch die Apostel, entfaltete und deutete das rettende Geschehen, wie das Wort Fleisch geworden und die Geschichte zur Heilsgeschichte umwandelte. Am Wort war das Wichtigste der Mensch, der sich in ihm offenbarte.
Insofern verstand sich das Christentum nicht als Buchreligion. Die Kirche hielt die Laien, soweit sie überhaupt lesen konnten, gar nicht dazu an, die Bibel zu lesen. Sie warnte davor, weil die Bibel in der Hand unkundiger Leser stets aller Unruhen, aller Häresien Ursache gewesen sei. Darauf wurde noch Martin Luther während seines Studiums in Erfurt hingewiesen. Aber seit dem 14. Jahrhundert suchten die Armen, und das heißt die Ohnmächtigen, nicht den Christus - König und Weltenherrscher. Sie suchten die Nähe des armen, gleich ihnen machtlosen Jesus, des Schmerzensmannes, des nackten Christus am nackten Holz, wie er ihnen in der Bibel begegnete. Damit steckten sie auch die Reichen und Mächtigen an. Es begann jetzt überhaupt erst die "Christianisierung" der Christen. Volkssprachliche Erbauungsschriften, wie Ludolf von Sachsens Leben Jesu oder Thomas a Kempis Nachfolge Christi - in alle europäischen Sprachen übersetzt -, ebneten einer ungewohnten Sehnsucht nach der Bibel, einer neuen, biblisch fundierten Religiosität den Weg.
Um den Willen Gottes zu erkennen, musste man darin geschult sein, die Sprache Gottes, die Christus spricht, zu verstehen, um in der Sprache, die Gott versteht, zu fragen und zu antworten auf Fragen, die er an jeden Einzelnen richtet. Die Erfindung des Buchdrucks und dessen stürmische Verbreitung seit 1456 ermöglichte den für damalige Verhältnisse massenhaften Absatz von Bibeln in der Volkssprache. Die Kirche misstraute dieser Bewegung und konnte sie doch nicht mehr aufhalten. Die Bibel steht am Anfang der Reformation, welche daher nicht mit den Thesen Luthers vom 31. Oktober 1517 beginnt. Sie hat eine Vorgeschichte, die Geschichte der vorreformatorischen Kräfte und Bewegungen. Deshalb beginnt Diarmaid MacCulloch seine Geschichte der Reformation, wie sie sich erst in Europa und dann in Amerika auswirkte, mit einem Rückblick auf das 14. und 15. Jahrhundert.
In Spanien ist die Reformation um 1520 abgeschlossen. Die Conversos, die neuen Christen, die von Juden abstammten, griffen gesamteuropäische Bemühungen auf, sich dem dramatischen Ereignis des liebenden Gottes persönlich zu stellen. Das meinte, sich genau zu prüfen, auf Christi Rede zu achten, wieder und wieder die Bibel zu lesen. Sie legten viel Wert auf die Gleichheit aller vor Christus und in Christus. Als Begeisterte unterstützten sie die Absichten der Könige und einiger Kirchenfürsten, die in Konventionen erstarrte Kirche zu neuem geistigen Leben zu erwecken. Es ging gar nicht so sehr darum, Missbräuche und Skandale abzustellen, sondern um eine neue Religiosität, um ein ganz eigenes, freies Verhältnis zu Christus und einem gnädigen Gott.
Das paganisierte Rom oder Florenz hält Diarmaid MacCulloch für eine Einbildung liberaler Ästheten des 19. Jahrhunderts. Die italienischen Reformatoren lösten sich freilich so wenig wie die spanischen von der alten Kirche, weil sie institutionell dachten und damit die Tradition, die Geschichte berücksichtigten. Spanier und Italiener beriefen sich auf den heiligen Augustinus - wie alle Reformatoren. Sie aber vergaßen bei allen Spekulationen über die Gnade und deren den Menschen erlösenden göttlichen "Überfluss" nie den Vater der Kirche, der ihr einen Begriff von sich selbst gab. Die geglückte Reformation ermöglichte Spanien für die nächsten einhundertfünfzig Jahre eine hegemoniale Stellung in Europa und eine imperiale in der Welt. Denn es war das einzige Land in Europa nach 1520, das nicht durch bürgerliche Unruhen und Verfassungsfragen gestört wurde, die mit der Gesamtverfassung zusammenhingen und ihrer Reform, die zugleich eine religiöse wie gesellschaftliche und politische bedeutete. Luther waren Staat und Gesellschaft ein weltlich Ding. Er war ein Prophet, dem es darum ging, die Freiheit eines Christenmenschen für sich zu finden und sie anderen zur Gewissheit werden zu lassen. Die Gnade allein sollte das bewirken und ihr heilsamer Quell, die Heilige Schrift und das heilige Wort. Luther, Zwingli, Calvin und deren europäische Schüler misstrauten der Tradition.
Sie wollten als von Christus Ergriffene das Christentum in eine Wortreligion verwandeln, im unverfälschten Wort die unverfälschte Person erkennen. Das konnte, wie sich bald zeigte, dazu führen, dass der Mensch Christus als das fleischgewordene Wort zum historisch-philologischen Wort verblasste oder auf den Zimmermannssohn Jesus beschränkt wurde, der an Gott glaubte und sich auf dessen Gnade verließ, ohne sonst viel von ihm zu wissen. Um das reine Wort zu gewinnen, musste das Wort von seiner geschichtlichen und unzuverlässigen Überlieferung gereinigt werden. Der reine Glaube, der sich von der Vermittlung des Priesters lösen wollte, brauchte nun die Philologie und alle weiteren historischen Wissenschaften, um sich seines Glaubens gewiss zu werden oder zu bleiben.
Wer sich von den historisch-philologischen Gottesgelehrten um den lebendigen Christus betrogen fühlte, rettete sich in alle möglichen Zirkel und Gemeinschaften. Dort ließen gleichgestimmte Seelen das Wort auf sich beruhen im Vertrauen auf den Geist Gottes, der sich in ihrem Inneren ausbreitete, sie erweckte und dazu erwählte, aufgrund dieser besondere Begeisterung tätig zu werden und die Welt zu heiligen. Auf anderen Wegen als die von ihnen verachteten Papisten kamen sie zu einer Werkgerechtigkeit, die ihnen ansonsten als "jesuitisch" höchst verdächtig war. Die Gnade und das Wort allein schufen keine Sicherheit, sie schufen nur weitere Schwierigkeiten und Widersprüche.
Die Folge der Reformation oder der Reformationen ist, wie Diarmaid MacCulloch unaufgeregt in ihrem ersten Stadium beobachtet, dass es keinen katholischen, also verbindlichen Begriff von Gottes Wort und dem Jesus als Christus gibt. Auch der katholische ist nur ein möglicher unter vielen. Gegen Luther oder Calvin protestierte die Römische Kirche. Sie musste, wie die unter sich uneinigen Protestanten, ihre Interpretation der Geschichte Christi historisierend verwissenschaftlichen. Im Pluriversum der christlichen Möglichkeiten, Fragen und Zweifel ist sie nur eine weitere reformierte, dauernd reformierende und gegen andere protestierende Einrichtung.
Darin sieht Diarmaid MacCulloch keinen Nachteil. Er setzt darauf, dass in allen Annäherungen an das Wort Gottes, das Mensch geworden ist, sich ein Teil der unendlichen und unbegreiflichen Wahrheit offenbart. Er fügt sich in das christliche Pluriversum, wie es sich seit dem 16. Jahrhundert entwickelte. Überall weht für ihn der Heilige Geist, wo drei sich in seinem Namen versammeln. Als Historiker weiß er allerdings, dass die Mächte der Geschichte mächtiger als die Kräfte des Heiligen Geistes sein können. Der große Gegensatz der katholischen Mächte Spanien und Frankreich, der Gegensatz des gesamten Hauses Österreich zu der maison de France, nötigte beide zu Kompromissen mit Lutheranern oder Kalvinisten.
Die Päpste, ohnehin abhängig von den Kaisern und Königen der casa de Austria, verbündeten sich meist mit dem französischen König und über ihn mit Lutheranern und Mohammedanern.
Die Eifersucht der katholischen Staaten gewährte den protestantischen die Möglichkeit, sich zu behaupten. Aber die Protestanten kannten ihrerseits keine Solidarität mit ihren vom "wahren Wort" ergriffenen Freunden des Evangeliums. Die Freiheit eines Christenmenschen, wie auch immer begriffen, verdankte sich Siegen und Niederlagen, politischen Abhängigkeiten oder Erwartungen. Die Reformation befreite nicht, sie machte in der Welt als Geschichte nicht glücklicher, aber alle mit ihr verbundenen Wirren sollten uns auch heute noch dazu aufmuntern, in einem Pluriversum einander zu ertragen lernen, statt eine universale Wertegemeinschaft anzustreben. Davor kann, wie Diarmaid MacCulloch hofft, die seit der Reformation übliche Vielfalt der Meinungen schützen. Die Vielfalt irritiert allerdings jene, die mit der Einfalt rechnen oder sie herstellen wollen.
Diarmaid MacCulloch: "Die Reformation 1490-1700". Aus dem Englischen von Helke Voß-Becher, Klaus Binder und Bernd Leineweber. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2008. 1024 S., 54 Abb., geb., 49,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Diarmaid MacCulloch schreibt eine grandiose Gesamtgeschichte der Reformation." Die Welt
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Anders als es manchem heute scheint, war das Christentum über Jahrhunderte keine "Buchreligion". Erst die Reformation beziehungsweise die Reformationen machten es dazu, oder, um - wie nach der Lektüre dieses Bandes nötig - genauer zu sein: schon die "vorreformatorischen Bewegungen", die sich bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen lassen. Was Diarmaid MacCulloch denn auch tut. In Spanien, als einzigem Land Europas, führte die Reformation - die 1520 beendet war - nicht zu tief greifenden Unruhen, sondern zur Erneuerung der "Religiosität". Radikaler waren Luther, Zwingli, Calvin, die in traditionskritischer Absicht den einzelnen Gläubigen direkt mit Gottes Wort in der Bibel konfrontieren wollten. Freilich erweist sich auch die Römische Kirche im Gefolge der Reformation als selbst "historisierend verwissenschaftlichter" Teil des neuen "Pluriversums" christlicher Religiosität. Der Historiker MacCulloch stellt sich ganz auf die Seite der Vielfalt, was ihm der Rezensent Eberhard Straub, der in seiner Besprechung sehr viel mehr referiert als wertet, keineswegs verübelt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH