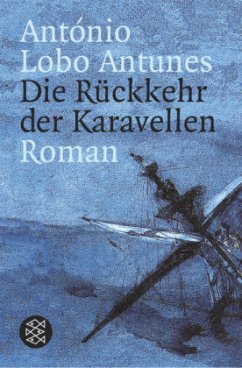So wie die deutsche Sage will, dass eines Tages der im Kyffhäuser schlafende Kaiser Friedrich alles zum Guten wendet, so haben die Portugiesen niemals an den Tod von König Sebastian geglaubt. Er ward zwar nicht mehr gesehen, seit er 1578 in Afrika vergebens versuchte, die Moslems zum rechten Glauben zu bringen, aber noch heute harrt das fromme lusitanische Volk seiner Wiederkehr. Antonio Lobo Antunes greift diese Legende auf, und vor dem König lässt er zunächst die bedeutendsten Entdeckungsreisenden auf ihren Karavellen den Atlantik noch einmal überqueren, um zwischen Öltankern und Flugzeugträgern auf Lissabon zuzusteuern. Pedro Alves Cabral ist unter ihnen, den es genau 500 Jahre, nachdem er Brasilien entdeckt hat, ins Rotlichtviertel verschlägt. Vasco da Gama, der als erster das Kap der Guten Hoffnung umsegelte, muss seinen Unterhalt mit kleinen Gaunereien verdienen. Und Luis de C., dem wir das portugiesische Nationalepos verdanken, beginnt seine Lusiaden auf dem Rechnungsb lock eines Kellners. Alle diese Männer, die Angola, Brasilien und Mo ambique für Portugal entdeckt haben, unterhalten sich mit den Menschen unserer Tage darüber, was aus den Neuen Welten geworden ist. Um diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen herzustellen, lässt Lobo Antunes mal die Sätze tropisch und barock wuchern, mal sich knäueln wie die Lianen des afrikanischen Urwalds oder die Ornamente des manuelinischen Baustils, mal schildert er lapidar und sarkastisch den heutigen Alltag, dazwischen lässt er ironische und komische Blitze leuchten.

António Lobo Antunes kehrt zurück / Von Alexander Kissler
Der Mann, der Sprechstunden hielt im Hospital Miguel Bombarda, war einst ein weizenblonder, unsportlicher Junge. Nun wohnt er im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses, ist Vater zweier Töchter und könnte António Lobo Antunes heißen. Seiner erlebten oder erträumten Kindheit widmete der Chirurg, Psychiater und Schriftsteller eine Sammlung kürzester Prosa, deutsch betitelt "Sonette an Christus". Bei der Suche nach dem Eigenen im camouflierten Biographischen stößt dort der Erzähler auf den Katechismusunterricht. Damals habe der weizenblonde Junge sich unter Gott ein "gasförmiges Wirbeltier" vorgestellt. Jahrzehnte später erst sei dieser Irrtum korrigiert worden: "Ich begriff, daß ich das gasförmige Wirbeltier war."
Das vierzehnte Kapitel des Romans "Rückkehr der Karavellen" erweitert nun diese Definition ins Phantastische: Weil gegen Verstopfung, Unfruchtbarkeit und Katalepsie ein Kraut gewachsen ist, wäre das portugiesische Nationalepos beinahe ungeschrieben geblieben. Die Schuld daran trüge der Botaniker Garcia da Orta, der auf dem Balkon Heilpflanzen züchtet. Das "medizinische Amazonien" beeindruckte zunächst auch seinen mittellosen Untermieter Luís de Camões. Keinen Augenblick zu früh bemerkt der spätere Nationaldichter den gewaltigen Appetit der Begonien. Die Familie des Botanikers nämlich fiel der Blume bereits zum Opfer. Luís de Camões flüchtet gerade noch rechtzeitig aus dem mörderischen Treibhaus. Sonst wären "Die Lusiaden" ungeschrieben geblieben.
Unmögliche Wesen sind der Naturheilkundler und der Schriftsteller aus dem sechzehnten Jahrhundert, die Lobo Antunes im Portugal des Jahres 1975 wiederauferstehen läßt. Sie zählen zur epidemischen Gruppe der "gasförmigen Wirbeltiere", die auch seinen jüngsten Roman bevölkern, das Meisterwerk "Anweisungen an die Krokodile". Welch langer Weg zu beschreiten war, ehe diese vier Monologe gedemütigter Frauen derart dicht gestaltet werden konnten, welche Schlacke auszuscheiden war, belegt nun "Die Rückkehr der Karavellen". Das bereits 1988 entstandene Buch versammelt die großen Themen des Gesamtwerks, doch nicht nur im vierzehnten Kapitel werden sie komisch statt tragisch, grotesk statt dämonisch verhandelt.
Anders als es die Kritik oft wahrhaben will, gilt das Interesse somit auch hier nicht der puren Niedertracht des Menschen, sondern dessen mangelhafter leiblicher wie mentaler Konstitution. Die Unmöglichkeit, als Mensch auf der Erde beheimatet zu sein, äußert sich schon 1988 in der Verwechselbarkeit von Natur und Ding, von Mensch und Tier: Männer haben ein hölzernes Kinn und greifen nach der "Leguanhaut des Halses", Frauen schleichen wie "behinderte Kröten" mißverstehen "sittenlose Automobile".
Sie alle sind austauschbare Glieder des Antunesischen "Universums dicht am Boden", wie es der debile Held des Romans "Portugals strahlende Größe" (1998) sein eigen nennt. In der "Rückkehr der Karavellen" heißt es von dem Zimmer des Bordellbetreibers Francisco Xavier, dort ende "alles sechzig Zentimeter über dem Boden, außer den Rissen in den Wänden". In Xaviers Schmuddelkneipe riecht es beständig "nach Schlaflosigkeit und Fußschweiß", gerne trinkt man deshalb duftintensiven Baumerdbeerenschnaps. Alle "Retornados", die aus den in die Unabhängigkeit entlassenen Kolonien 1975 nach Lissabon zurückkehren und denen Lobo Antunes die Namen und die Vita von Entdeckern gibt, trauen ihren Nasen nicht mehr. Sie durchstreifen ziellos die Hauptstadt, dieses "Labyrinth aus Fenstern" und Treppchen, die "zu keinem anderen Ort führen als zu sich selbst".
Das Ich aber bleibt unauffindbar; es ist die trotzige Utopie überlebter Gestalten. Den Kampf ums Subjekt präsentiert Lobo Antunes mit grandiosem Einfallsreichtum. Entfernteste Bildbereiche verknüpft er zu poetischen Neuschöpfungen und flicht seitenlange Satzgirlanden, innerhalb deren ein "Komagelee" den Tiefschlaf meint oder aus Metallstangen "Geweihe eingegrabener Rentiere" werden. Zuweilen jedoch kapituliert der Autor vor dem Inventar seiner Phantasie, reiht er Substantiv um Substantiv ermüdend statt erhellend aneinander: Der Kanzleistil triumphiert "jenseits der Zikaden der Dunkelheit, deren Schrillen dem Sirren der Pailletten der Schlaflosigkeit ähnelt". Ausnahmslos bizarr muten die Bemühungen der heimgekehrten Greise an, Portugals goldene Zeit wiederaufzurichten. Auch die Narren, Huren und Monarchen des vorliegenden Buches sind "schon vor Ewigkeiten auf die düstere Seite der Hoffnung übergewechselt". Nur so erhalten sie das Bleiberecht in einem Werk von weltliterarischer Geltung, das die zwingend tragische Geschichte stillstellen möchte. Was in der mit dem "Handbuch der Inquisitoren" begonnenen, mit den "Anweisungen an die Krokodile" beendeten Trilogie über Macht und Gewalt durch Zeitdehnung erreicht wird, geschieht hier mittels Zeitraffung. Die extrem beschleunigten Zeiten treffen aufeinander, das sechzehnte Jahrhundert feiert im zwanzigsten seine Neugeburt, ein surreales Portugal verbrennt, "um das Volk milde zu stimmen, Ketzer auf kleinen Kasperletheaterbühnen".
Indem Lobo Antunes Geschichte als ein Kontinuum suspendiert, folgt er einem Programm von 1800. Das Märchen, zu dem romantischer Überzeugung gemäß die Geschichte werden muß, imaginiert "Die Rückkehr der Karavellen" mit suggestiven Bildern und analytischer Brillanz. Lobo Antunes bewegt sich schwerelos in jener "Atmosphäre des Dichters", die nach einem Wort Novalis' entsteht, sobald Vergangenheit und Zukunft "durch Auflösung identifiziert" werden. Lobo Antunes ist weit davon entfernt, dem Imperialismus das Wort zu reden, aber sein geschichtskritisches Werk nährt sich von der zu überwindenden Historie. Die "revolutionären Schlafanzüge", die wider besseres Wissen auf einen König warten, wären ohne diese romantische Moral undenkbar.
Die große Hoffnung Vasco da Gamas und der anderen Wiedergänger kann sich nicht erfüllen, doch sie halten ihr die Treue. Sie wünschen nichts sehnlicher, als daß "der Kalender wieder ruhig funktioniert". Kalender aber lügen stets, und Ruhe schenken sie nie. Schon ein weizenblonder Junge aus Lissabon ahnte diesen traurigen Zusammenhang. Mit dreizehn Jahren begann er, für seine Großmutter "Sonette an Christus" zu schreiben. Bloße Märchen waren sie ihm, doch der Kuß, den er zur Belohnung erhielt, sprach wahr. Vielleicht bedarf es in frostigen Zeiten zeitloser Märchen, um ein Herz aufzuschließen.
António Lobo Antunes: "Die Rückkehr der Karavellen". Roman. Aus dem Portugiesischen übersetzt von Maralde Meyer-Minnemann. Luchterhand Verlag, München 2000. 286 S., geb., 38,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main