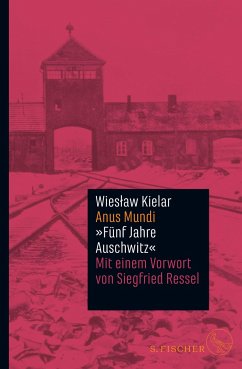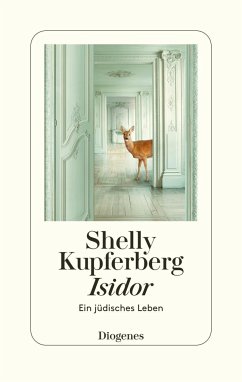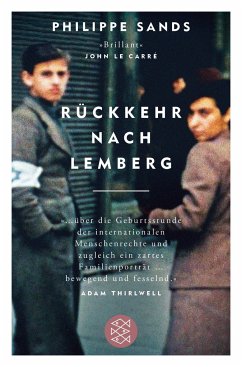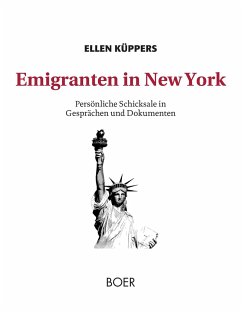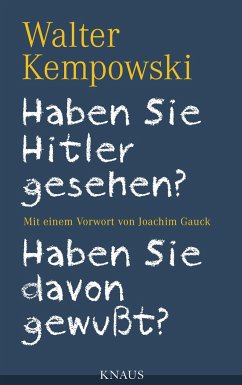Die Rückkehr des Hooligan
Ein Selbstporträt. Ausgezeichnet mit dem Prix Medicis für ausländische Literatur 2006 und von der Darmstädter Jury als Buch des Monats März 2004 ausgezeichnet
Übersetzer: Aescht, Georg
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 3-5 Tagen
26,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Norman Manea wurde zum Augenzeugen zweier Schreckensherrschaften: mit fünf Jahren wurde er als Kind jüdischer Eltern nach Transnistrien deportiert, mit fünfzig war er gezwungen, aus Ceaucescus Rumänien zu emigrieren. Seine Autobiographie ist ein "Buch der Wut" (Charles Simic) und das Porträt eines Heimatlosen, dem das Schreiben zum einzigen Vaterland wurde.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.