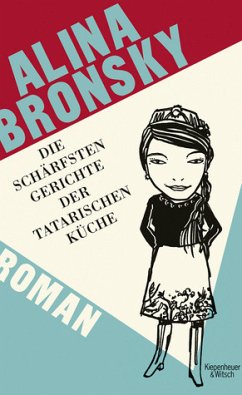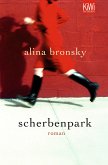Die Geschichte der leidenschaftlichsten und durchtriebensten Großmutter aller Zeiten Am Anfang tut sie alles, um nicht Großmutter zu werden: Im Jahr 1978 ist Rosalinda wild entschlossen, die Schwangerschaft ihrer viel zu jungen und viel zu dummen Tochter zu beenden. Doch das misslingt, und sobald Aminat auf der Welt ist, entbrennt ein rücksichtsloser, grotesk-komischer Kampf um sie. Jenseits des Urals herrschen klare Verhältnisse: Die Tatarin Rosalinda bestimmt, ihr Gatte Kalganov spurt, und ihre Tochter Sulfia benimmt sich schlecht. Es mangelt an vielem, aber nicht an Ideen, und schon gar nicht an Willenskraft. Es steht also immer etwas Scharfes auf dem Tisch, und alle größeren Malheurs, die Sulfia anrichten könnte, werden verhindert. Nur ihre Schwangerschaft nicht, und auch nicht die Geburt von Aminat, dem genauen Gegenteil ihrer Mutter: schön, schlau, durchsetzungsfähig ganz die Großmutter eben. Rosalinda steht zum ersten Mal einem Geschöpf gegenüber, das ihr ebenbürtig ist, und wird die leidenschaftlichste Großmutter aller Zeiten. Im ungleichen Kampf zwischen der glücklosen Sulfia und der rücksichtslosen Rosalinda wird das Mädchen zur Wandertrophäe und der Leser zum Zeugen haarsträubendster Ereignisse, komischster Szenen, schlagfertigster Dialoge. Alina Bronsky gelingt eine Glanzleistung: Sie lässt ihre radikale, selbstverliebte und komische Hauptfigur die Geschichte dreier Frauen erzählen, die unfreiwillig und unzertrennlich miteinander verbunden sind in einem Ton, der unwiderstehlich ist. Durch drei Jahrzehnte und diverse Schicksalsschläge führt sie die ungleichen Frauen, und der Leser folgt ihr atemlos. Voller Gefühl, Sinnlichkeit, Drastik und Exotik: ein scharfer Frauenroman!

Harte Heldinnen: Alina Bronsky, die gar nicht Alina Bronsky heißt, weiß nicht nur, wie eine böse Oma aussieht, sie kennt auch die Träume junger Mädchen
Der Titel gefiel mir nicht besonders. Er war zu lang, klang nach Kochbuch und sagte mir überhaupt nichts: "Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche". Was sollte das sein? Jedenfalls erwartete ich nicht viel, als ich vor zwei Jahren Alina Bronskys zweiten Roman zu lesen begann. Den ersten kannte ich nicht. Ich erinnerte mich daran, dass die Autorin, 1978 in Jekaterinburg geboren, in Marburg und Darmstadt aufgewachsen, 2008 beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt aufgetreten und von der Jury in einer Weise behandelt worden war, die einem, wie so oft, Lust machte, das Bachmannpreisübertragungsfernsehen sofort wieder auszumachen. Sie sei eine "Ausnahmebegabung", wurde Alina Bronsky da bescheinigt, ihre Erzählhaltung aber "überflüssig scheinkindlich", "pseudonaiv", "nicht interessant", überhaupt sei das alles mit "fabrizierter Schlitzohrigkeit" geschrieben. Oder, wie der damals in der Jury sitzende Schweizer Schriftsteller André Vladimir Heiz, offenbar kein Freund der Unruhe, ablehnend meinte: Er werde beim Lesen zwischen Faszination und Schrecken hin- und hergebeutelt und finde deshalb "nicht zu einer Leseruhe".
"Als meine Tochter Sulfia mir sagte, sie sei schwanger, wisse aber nicht, von wem", hieß der erste Satz des tatarischen Küchenromans, den ich ein bisschen widerwillig zu lesen begann, "habe ich verstärkt auf meine Haltung geachtet. Ich hielt meinen Rücken sehr gerade und die Hände würdevoll im Schoß gefaltet." Das war ein schöner und ungewöhnlicher Satz. Verglichen mit dem, was folgte, war er, wie sich herausstellte, allerdings völlig harmlos. Denn schon im zweiten Satz fing der Hass an: "Sulfia saß auf einem Küchenhocker. Ihre Schultern waren hässlich hochgezogen und die Augen rot, weil sie die Tränen nicht einfach laufen ließ, sondern mit dem Handrücken im Gesicht verrieb. Und das, obwohl ich sie von klein auf gelehrt hatte, wie man weint, ohne hässlich zu werden, und wie man lächelt, ohne zu viel zu versprechen. Aber sie war nicht begabt. Ich muss sogar sagen, sie war ziemlich dumm. Dabei war sie meine Tochter."
Das gab es in der Gegenwartsliteratur ziemlich selten: Die Figur, die Alina Bronsky da erfunden hatte und die sich auf den ersten Romanseiten auf perfide Weise mit dem Leser zu verbünden, ihn sich zum Komplizen zu machen versuchte, war gehässig und böse, unerbittlich und grausam. Und sie war dies nicht willkürlich gegen alle oder irgendwen, sondern, darin bestand die besondere Grausamkeit, vor allem gegen jene, die andere ihre "Liebsten" nennen würden: gegen ihre einzige Tochter, gegen Freundinnen und gegen ihren Mann. Rosalinda war ihr Name, eine Tatarin, Tyrannin und Herrscherin eines heimlichen Matriarchats, wie man es jenseits des Urals findet: "Es gibt in Osteuropa diese tyrannischen Mutterfiguren, die die Familie massivst missbrauchen", hat Alina Bronsky in einem Interview gesagt, wobei mit Tyrannei nicht nur eine sprachliche gemeint war, die sich in entfesselten Hasstiraden Bahn bricht, sondern zugleich eine vollkommen mitleidlose körperliche Brutalität.
Indem sie ihr ein beinahe kochend heißes Bad mit Senfpulver verordnet, zwingt die Tatarin ihre ungeliebte Tochter zur Abtreibung: "Zieh dich aus", "Steig ein", "In der Hölle ist es noch heißer", lauten ihre Ansagen, bis sie die Tochter, die bald ohnmächtig, mit knallroter Haut und aufgerissenem Mund im Badewasser liegt, dann doch aus der heißen Brühe wieder herauszuziehen bereit ist und eine Freundin ("diese dumme Pute") mit der Stricknadel anrücken lässt. Die scheint Erfolg zu haben, Sulfia blutet tagelang und dabei hoch fiebernd "wie ein Schwein". Nur hat die zielsichere Abtreibungsexpertin, die eigentlich eine Putzfrau ist, von Zwillingen nichts wissen können. So wird doch eine Enkelin geboren, Aminat, die von nun an - und das muss als Bedrohung verstanden werden - Rosalindas Ein und Alles ist: "Ich wusste, dass Kinder wie ein Gemüsebeet behandelt werden sollten. Wenn man Unkraut aus ihrem Charakter beseitigte, erhielt man eine bessere Ernte."
Einen bösen und gehässigen Charakter zu entwerfen ist das eine; die Konsequenz, mit der Alina Bronsky das betreibt, ist beeindruckend. Ihren Höhepunkt findet sie, als Rosalinda die Enkelin an einen Pädophilen in Deutschland verkauft: Das Mädchen kann bei ihm wohnen, wenn, so die Bedingung, Mutter und Großmutter aus der Sowjetunion mit in den Westen gehen können. Und so kommt es dann auch.
Das andere aber ist, dass Alina Bronsky ihre grausame Heldin an keiner Stelle denunziert, genauso wenig, wie es dem Leser gelingt, sich von dieser Figur, die im Roman die Ich-Erzählerin ist und zu deren Komplizen man beim Lesen unwillkürlich wird, vollständig zu distanzieren. Rosalinda ist furchtbar. Aber sie ist sich dessen überhaupt nicht bewusst. Sie ist der Überzeugung, für ihre Umgebung das Beste zu wollen. Und man glaubt es ihr sogar: "Ich will keine böse Oma haben. Ich will keine böse Oma haben", schreit die Enkelin sie mit ihrer kleinen Stimme irgendwann an, und Rosalinda ist schwer verwundert: "War ich eine böse Oma? Ich betrachtete mein Spiegelbild in der schmutzigen Fensterscheibe des Trolleybusses. Sah so eine böse Oma aus? Ich sah überhaupt nicht wie eine Oma aus. Ich sah gut aus. Ich war eine schöne Frau und noch nicht alt. Man sah mir an, dass ich Kraft hatte und intelligent war."
Alina Bronsky schafft es auf diese Weise nicht nur, eine komplexe und zugleich paradoxe Figur des um das Gute bemühten Bösen zu schaffen. Sie macht dies vor allem in einer direkten, völlig schnörkellosen, niemals artifiziellen und sehr komischen Sprache, die ziemlich einzigartig ist unter den jungen Autorinnen und Autoren. Ernst zu sein ist ziemlich einfach, trübsinnig auch, und einen ironischen Ton kriegen die meisten ohne weiteres hin. Aber mit grammatisch nicht besonders komplexen Sätzen Komplexität und zugleich Komik herzustellen, das ist, so wie es Alina Bronsky tut, ein Kunststück, für das man sie einfach bewundern muss.
Als sie damals in Klagenfurt eingeladen war, war der Text, den sie vorlas und über den in der Bachmannpreisjury schnell feststand, dass man mit ihm sicher "keinen Büchnerpreis gewinnen" könne (so viel zur Komik der Bachmannpreisjury), das erste Kapitel ihres ersten Romans "Scherbenpark", der später selbst von Kritikern gelobt wurde, die ihren "Kleinmädchenauftritt" in Klagenfurt nicht hatten ernst nehmen wollen. "Scherbenpark", das ist der Park hinter einem Haus irgendwo in Hessen, einem Getto der Russlanddeutschen, in dem es krass zugeht und in welchem die 17-jährige Sascha wohnt: "Manchmal denke ich", sagt sie, "ich bin diese Einzige in unserem Viertel, die noch vernünftige Träume hat." Genau genommen sind es zwei Träume: Sie will ihren Stiefvater töten, der im Gefängnis sitzt, weil er Saschas Mutter und deren Liebhaber erschossen hat. Und sie will ein Buch über ihre Mutter schreiben.
Alina Bronsky, die heute 34 Jahre alt ist und Mutter von drei Kindern, kam mit ihren russischen Eltern, einer Astronomin und einem Physiker, nach Deutschland, als sie 13 war, und konnte kein Wort Deutsch. Sie lernte schnell, machte Abitur und begann, in deutscher Sprache zu schreiben. Dass autobiographische Romane sie nicht interessierten, hat sie, gerade anlässlich von "Scherbenpark", als es um das Getto der Russlanddeutschen ging, immer wieder betont und alles Private, sogar ihren wirklichen Namen, im Verborgenen gehalten. Alina Bronsky ist ein Pseudonym, und der Tonfall dieser Alina Bronsky ist unverwechselbar. Vergessen wir also Klagenfurt. Und freuen uns auf den nächsten Roman von Alina Bronsky.
JULIA ENCKE
Alina Bronsky: "Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche". Roman. Kiepenheuer & Witsch 2010, 320 Seiten, 18,95 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Als Balanceakt zwischen Klamotte und Tragikomödie begeistert Rezensentin Iris Radisch diese ungewöhnliche wie abgründige russische Einwandergeschichte, der sie Charme, Cleverness, eine große zynische Nonchalance und kühle Ironie bescheinigt. Denn nicht nur die listige, scharf kalkulierende Erzählhaltung der Autorin, auch das weibliche Monster von Familienoberhaupt hat es der Kritikerin angetan - für sie eine emblematische Nachfahrin der Matroschka, die sie mit unsentimentalen - vermutlich "im Stalinismus erworbene" - Überlebenstechniken beeindruckt. Das matriarchische Regiment scheint am Ende dazu zu führen, dass neben der Großmutter nur die Enkelin überlebt (alle anderen sterben an Entkräftung), die einen pädophilen deutschen Akademiker heiratet und damit endlich eingebürgert wird. Radisch hatte großes Vergnügen mit diesem Roman, auch wenn er manchmal die Grenze zum Klamauk überschreite.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Nach "Scherbenpark" der zweite Bestseller. "Alina Bronsky lässt das Muttermonster munter aus der Schule der Diktatoren plaudern - grausam und ulkig." Stern "Ihr rasanter Stil ist zwingend, die Geschichte unterhaltsam und fesselnd, die Sprache witzig und böse." NDR "Beißend komisch" The New Yorker
»Eine aberwitzige coole Story. Die schärfsten Gerichte der tartarischen Küche ist kein Melodram, sondern ein emanzipatorisches Märchen.« 1LIVE