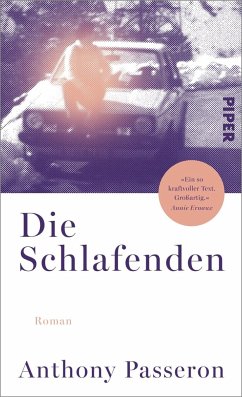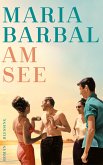»Ein so kraftvoller Text. Großartig.« Annie Ernaux
In der Familie taten immer alle das Gleiche, sobald es um Désiré ging. Der Vater und der Großvater hüllten sich in Schweigen. Die Mutter unterbrach ihre knappen Kommentare stets mit demselben Spruch: »Das ist schon alles sehr traurig.« So beschlagnahmte jeder auf seine Weise die Wahrheit - doch die ganze Wahrheit bestand darin, dass Onkel Désiré 1983 aus seinem südfranzösischen Dorf nach Amsterdam abhaute, dem Heroin verfiel und die konservative Metzgerfamilie in Verzweiflung stürzte.
»Die Schlafenden« erzählt von einer Epoche des Chaos in der französischen Provinz, von der Heroinepedemie und einer grassierenden neuen Krankheit namens AIDS, von Scham und Trauer einer Familie, die einmal zu den angesehensten ihres Dorfes zählte.
»Fehlende Wort sind das, woraus dieser erste Roman gemacht ist. Passeron versucht, den verlorenen Faden einer Familie wieder aufzunehmen, die sich verängstigt und beschämt jede Trauer versagte. Mit großem Feingefühl verwebt Passeron dabei die Geschichte einer Krankeit mit der persönlichen Tragödie, in die der Zufall eine Familie stürzte.« Livres Hebdo
Vielfach preisgekrönt, u.a. mit dem Prix Première und dem Prix Première Plume
In der Familie taten immer alle das Gleiche, sobald es um Désiré ging. Der Vater und der Großvater hüllten sich in Schweigen. Die Mutter unterbrach ihre knappen Kommentare stets mit demselben Spruch: »Das ist schon alles sehr traurig.« So beschlagnahmte jeder auf seine Weise die Wahrheit - doch die ganze Wahrheit bestand darin, dass Onkel Désiré 1983 aus seinem südfranzösischen Dorf nach Amsterdam abhaute, dem Heroin verfiel und die konservative Metzgerfamilie in Verzweiflung stürzte.
»Die Schlafenden« erzählt von einer Epoche des Chaos in der französischen Provinz, von der Heroinepedemie und einer grassierenden neuen Krankheit namens AIDS, von Scham und Trauer einer Familie, die einmal zu den angesehensten ihres Dorfes zählte.
»Fehlende Wort sind das, woraus dieser erste Roman gemacht ist. Passeron versucht, den verlorenen Faden einer Familie wieder aufzunehmen, die sich verängstigt und beschämt jede Trauer versagte. Mit großem Feingefühl verwebt Passeron dabei die Geschichte einer Krankeit mit der persönlichen Tragödie, in die der Zufall eine Familie stürzte.« Livres Hebdo
Vielfach preisgekrönt, u.a. mit dem Prix Première und dem Prix Première Plume

Der wissenschaftliche Durchbruch kommt zu spät: Anthony Passerons Aids-Roman "Die Schlafenden"
Camus' "Pest" gibt den Ton vor: "Die Ratten sterben auf der Straße und die Menschen in ihrem Zimmer." Vor gerade einem Jahr wurde offiziell die Corona-Epidemie, die weltweit fast sieben Millionen Todesopfer gefordert hat, für beendet erklärt, von einer Aufarbeitung sind wir noch weit entfernt. Fast schon vergessen ist, welche Verheerungen fast 25 Jahre lang das HI-Virus mit 36 Millionen Toten angerichtet hat, bis es endlich wirksam bekämpft werden konnte. Welches Leid das für Betroffene bedeutet hat, die oft einsam starben, ausgegrenzt und mit Verachtung behandelt, auch vom Pflegepersonal, welche Konsequenzen das für die Angehörigen hatte, die häufig in Scham und Schweigen versanken, haben wir längst wieder vergessen.
Ein junger französischer Autor hat nun einen bemerkenswerten preisgekrönten Debütroman zu diesem Thema vorgelegt, der zwei Erzählstränge kunstvoll verknüpft. Zum einen die Geschichte seiner Familie, die den Aids-Tod des ältesten Sohnes, seiner Frau und seiner kleinen Tochter zu einem Familiengeheimnis macht, an das nicht gerührt werden darf, und zum anderen den minutiösen Bericht über die verzweifelten Anstrengungen französischer und amerikanischer Forscher, den Wettlauf gegen den Tod zu gewinnen. Dem Autor gelingt auf diese Weise ein zugleich ungemein berührender wie fast thrillerhaft spannender Roman, den man trotz der wissenschaftlichen Begrifflichkeit im Rechercheteil nicht aus der Hand legen kann.
Anthony Passeron hat das autofiktionale Schreiben von Annie Ernaux gelernt, auf deren Roman "Das Ereignis", der Geschichte ihrer heimlichen Abtreibung als junge Studentin, er sich ausdrücklich bezieht. Wie die Grande Dame der französischen Literatur verbindet er das Private mit dem Gesellschaftlichen, verbindet die intime romaneske Erzählung mit einem gesellschaftlichen, quasidokumentarischen Erzählteil. Es ist ein Schreiben gegen das Vergessen. Er selbst sieht sein Schreiben als eine späte Wiedergutmachung für diejenigen, die als Parias gestorben sind und in Bleisärgen beerdigt wurden. Ausgegrenzt und stigmatisiert, im Teufelskreis von Schuld und Sühne, Sünde und Strafe, irdisch wie himmlisch, Schande, Schweigen und Vergessen. Er sieht sein Buch als "letzten Versuch, dass etwas überdauert". Es vermische Erinnerungen, unvollständige Geständnisse und belegbare Rekonstruktionen. Er will erzählen, wie seine Familie durch eine "absolute Einsamkeit" gehen musste und dabei zerbrach.
Er zögert lange mit dem Schreiben, aus Angst, seine Sicht statt der ihren wiederzugeben, bis ihm klar wird, dass Schreiben die einzige Möglichkeit ist, damit die Geschichte seines Onkels und seiner Familie nicht untergeht wie schon das Dorf, in dem sie lebten, im gebirgigen Hinterland von Nizza, nahe der Grenze zu Italien, Opfer des gesellschaftlichen Strukturwandels.
Es ist eine Aufsteigerfamilie, die es aus bitterer Armut durch harte Arbeit als Metzger zu Wohlstand und Ansehen gebracht hat und die alles dafür tut, dass es die nächste Generation besser hat. Désiré, der Erwünschte, ist dann auch der verwöhnte Erstling, der die Familie in Einsamkeit und Schande stürzen wird.
Schon der Romanauftakt ist furios: Auf die Frage des Erzählers an seinen Vater, welches die am weitesten entfernte Stadt sei, die er gesehen habe, antwortet er nur knapp "Amsterdam", während er weiterhin Tiere zerlegt und ihm das Blut ins Gesicht spritzt, mehr will er nicht sagen, sein Kiefer verkrampft sich. Zum ersten Mal in seinem Leben hört der Erzähler den Namen seines Onkels, hingeworfen wie einen Knochen. Das Weitere findet sich in einem alten Schuhkarton mit Fotos von Geburtstagen und Familienfesten und auf ebenso alten Super-8-Filmen mit dem gleichen Inhalt. Fragen dazu möchte die Mutter nicht beantworten. "Das ist alles sehr traurig", sagt sie nur. Da hat der Vater die Familie längst verlassen, die Großeltern sind tot, der Onkel vergessen. Der Autor selbst ist ein Kind, als sein heroinsüchtiger Onkel 1987 mit kaum dreißig stirbt. Er weiß nichts von ihm, spürt nur die erdrückende Last eines Familiengeheimnisses.
Wie der Originaltitel "Les enfants endormis" ("Die schlafenden Kinder") schon andeutet, ist der Onkel des Erzählers nicht der Einzige, der vor der Ödnis der kleinbürgerlichen Gegenwart der Elterngeneration in künstliche Paradiese flüchtet, die Spritze verschafft Zugang zum "ailleurs". Achtundsechzig hat man verpasst, aber jetzt will man so leben wie die Poeten und Musiker ihrer Generation, schnell und intensiv, und nicht im Büroalltag eines Notars versauern. Die bittere Pointe für die Eltern ist die Tatsache, dass Désiré der Erste der Familie war mit Abitur und Studium, damit aber auch mit mentalem Zugang zu anderen Welten. Die Entfremdung vom Herkunftsmilieu oder die daraus entstehenden Schuldgefühle werden weggefixt und von beiden Seiten geleugnet, bis zum bitteren Ende. Wie so viele damals stirbt auch Désiré an "Lungenembolie". Die Wahrheit war jahrelang mit Eau de Javel, der bekannten Chlorbleiche, weggesprüht worden. Für den Erzähler bleibt der Chlorgeruch eine prägende Erinnerung.
Eingestreut in den Roman sind auch zwei prominente Beispiele: Der große Philosoph Michel Foucault stirbt qualvoll an Aids, ohne davon zu erfahren. Sein Lebensgefährte entdeckt die Diagnose zufällig nach dessen Tod auf einer Krankenakte. Rock Hudson, der als einer der ersten Prominenten seine Krankheit öffentlich gemacht hatte, will sich in Paris behandeln lassen, wird als Patient ebenso abgelehnt wie als Flugpassagier: Für seinen Rückflug muss er allein eine Boing 747 chartern. Er stirbt wenige Wochen danach.
Die traurige Familiengeschichte gipfelt in der langen Agonie der kleinen Tochter Émilie, die nach dem frühen Tod ihrer infizierten Eltern liebevoll umsorgt bei den Großeltern aufwächst, aber pränatal ebenfalls infiziert ist. Nach zehn Lebensjahren gibt ihr kleiner Körper auf, trotz Wasser aus Lourdes von den Dörflern und der Künste eines Magnétiseurs. Der wissenschaftliche Durchbruch kommt zu spät. Für sie wird es ein winziger weißer Bleisarg sein. Nach dem Familienmythos wird Émilie wie ihre Eltern in den blauen Sommernächten über die dunklen Berge zu den Sternen aufsteigen. Auch auf dem Höhepunkt der Aids-Pandemie verbietet Papst Johannes Paul II. die Benutzung von Kondomen.
Der zweite Erzählstrang bietet interessante Einblicke in 25 Jahre Wissenschaftsgeschichte im Kampf gegen die moderne Pest bis hin zum Nobelpreis 2008 für Françoise Barré-Sinoussi und Luc Montagnier nach endlich erfolgtem Durchbruch. Erschreckend ist die Rivalität zwischen französischen und amerikanischen Forschern, wobei Letztere die Ergebnisse ihrer Kollegen immer wieder desavouieren.
Der Autor präsentiert uns ein düsteres Familienepos und komplizierte wissenschaftliche Zusammenhänge in einer klaren, schnörkellosen Sprache ohne Larmoyanz und Pathos, eindringlich und engagiert, getragen von großer Sympathie für seine Figuren. Ein Roman als Requiem. BARBARA VON MACHUI
Anthony Passeron: "Die Schlafenden". Roman.
Aus dem Französischen von Claudia Marquardt. Piper Verlag, München 2024. 256 S., geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Ist das überhaupt noch ein Roman, fragt sich Rezensent Gustav Seibt angesichts Anthony Passerons Buch, das der autofiktionalen Literatur zuzurechnen ist. Wobei in diesem Fall nicht der Autor, sondern dessen Onkel Désiré im Zentrum steht, der zu den ersten Opfern der Aids-Pandemie zählt. Ort der Handlung ist, erfahren wir, eine französische Kleinstadt, das Personal rekrutiert sich hauptsächlich aus einer Metzgerfamilie. Passeron schließt an klassische französische Provinzromane an, beschreibt Seibt, aber landet bei einer Form der Geschichtsschreibung, die die Familienchronik mit dem Kampf gegen AIDS verschränkt. Auch mentalitätsgeschichtlich ist das interessant, so der Rezensent, etwa wenn die teils skurrilen Heilungsversuche von Désirés Verwandtschaft thematisiert werden. Ein trauriges Buch ist das, stellt der insgesamt ziemlich beeindruckte Rezensent klar, aber gleichzeitig enthält es Spurenelemente der Komik, die es in große und wichtige Kunst verwandeln.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Anthony Passeron erweist sich bei seinem Debüt bereits als routinierter Erzähler, der die beiden Handlungen in schlaglichtartigen Kapiteln zügig dem von vorneherein feststehenden Ende entgegenschreiten lässt.« (A) ORF - Ö1 Ex libris 20240519