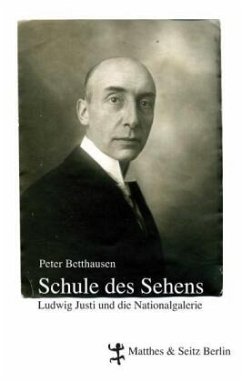Vor dem Hintergrund der großen politischen Umbrüche des 20. Jahrhunderts schildert Peter Betthausen detail- und kenntnisreich eine der imposantesten und längsten Museumskarrieren der deutschen Geschichte. Ludwig Justi prägte und gestaltete als Direktor der Berliner Nationalgalerie (1909-1933) und als Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin in der DDR (1946-1957) annähernd fünfzig Jahre das Kunst- und Museumsleben Berlins.

Im Dienst der Bilder vom Kaiserreich bis zur DDR: Peter Betthausen hat dem Museumsmann und Kunsthistoriker Wilhelm Justi eine fesselnd geschriebene Biographie gewidmet.
Ludwig Justis Verbindung mit der Berliner Nationalgalerie umspannte fast fünfzig wechselvolle, dramatisch unterbrochene Jahre: von 1909 bis 1957, vom Kaiserreich bis in die frühe DDR. Er wirkte als Direktor und öffentlicher Sammler, als Bildungspolitiker, als Gelehrter und Kenner, als klug vermittelnder Streiter und Kunstdiplomat. In den zwölf finsteren Jahren wurde er als Direktor von den Nationalsozialisten entlassen und in den Ruhestand gezwungen und musste mitansehen, wie sein Aufbauwerk und seine Ankäufe moderner Kunst durch die Kunstverfolgung zerstört wurden. Nach 1945 stieg dieser noble, durch und durch bürgerliche Kunsthistoriker zum Generaldirektor der Berliner Museumsinsel auf. Werner Schmidt, einer seiner damaligen Assistenten, erzählte, dass noch Walter Ulbricht Justi voller Respekt mit "Herr Geheimrat" angeredet habe.
Ludwig Justi (1876 bis 1957) ersetzte 1909 Hugo von Tschudi, den legendären Direktor der Nationalgalerie, der ihre chauvinistische Verengung und akademische Erstarrung gesprengt und den modernen Franzosen einen großen Auftritt verschafft hatte. Tschudi hatte nach heftigen Konflikten mit den Akademikern und mit dem Kaiser resigniert und war nach München gegangen. Der Schweizer war ein souveräner, entschiedener, wohl auch schroffer Überzeugungstäter, der früh im französischen Impressionismus und Postimpressionismus die befreiende, weltläufige Zukunftskunst erkannte und mit ihr die nationale Historienmalerei und den Akademismus zurückzudrängen versuchte. Er wollte die von Künsterlobbys beherrschte Nationalgalerie zu einem weltoffenen modernen Museum machen. Justi war eher ein Gegentyp, ein Vermittler zwischen Tradition und Moderne, der es vermied, den Kaiser und die Traditionalisten vor den Kopf zu stoßen, der vielmehr den Umbruch auf behutsame Weise vollziehen wollte.
Peter Betthausen, der letzte Direktor der Nationalgalerie-Ost, beschreibt in seiner fesselnd geschriebenen Biographie eindringlich Justis Kunst des Balancierens, des Ausgleichs und auch des Kompromisses. Justi gewann sogar das Vertrauen Wilhelms II., den er vorsichtig von seinem Dogmatismus abzubringen versuchte. Noch zu Kaiserzeiten erwarb er Werke von Liebermann, Corinth und Slevogt. Schließlich duldete der Kaiser auch die weitere Öffnung und Internationalisierung der Nationalgalerie. Justi kaufte gleichzeitig Franzosen und Deutschrömer. Denkwürdig ist seine letzte, zufällige Begegnung mit dem Kaiser in den Tagen des Kriegsausbruchs von 1914, die Justi in seinen Erinnerungen überliefert. Wilhelm ruft dem Museumsdirektor beim Ausritt im Tiergarten zu, dass es nun einstweilen wohl nichts mehr mit der Kunst werde: "Aber vielleicht bringen wir Ihnen etwas Schönes aus Paris mit!"
Die Berufung an die Nationalgalerie riss Justi 1909 aus der Arbeit an einem Giorgione-Buch. Als er 1933 seinen Dienst quittieren musste, wandte er sich wieder Giorgione und Dürer zu, die zu seinem inneren Exil wurden. Justi hatte einen festen Rückhalt in der Kunstgeschichte. Fast könnte man sagen, dass er schon im Aufbruch der Moderne ein Postmoderner war, der sich keinen Theorien oder avantgardistischen Richtungen verschrieb. Doch forderte er bereits bei seinem Amtsantritt ein neues Museum für das 20. Jahrhundert, reduzierte entschlossen die ranzige Historienmalerei und kämpfte für eine selbständige Galerie der Moderne im Kronprinzenpalais, die schon 1919 eröffnet werden konnte.
Dank seiner Beweglichkeit überlebte Justi die Kaiserzeit und führte die Nationalgalerie in die Republik. Für ihn schlossen sich Impressionisten und Deutschrömer, Expressionisten und Romantiker nicht aus. Erich Heckel und Hans Thoma waren seine deutschen Favoriten. Trotz seiner Diplomatie galt er den Konservativen dabei als "Altachtundvierziger" und zog sich auf der anderen Seite die erbitterte Gegnerschaft der liberalen und großbürgerlichen Fortschrittsfraktion in Berlin zu, die in Justi nur den kaisertreuen Günstling und Karrieristen sehen wollte und im Impressionismus den Angelpunkt der Moderne. Justi dagegen, in seiner Kunstauffassung gleichfalls vom malerischen Sensualismus des Impressionismus durchdrungen, sah als Historiker in Letzterem eher einen Übergang, ein Gelenk der Kunstgeschichte.
Nach 1919 überholte der konservative Justi die Impressionisten-Generation und sah sich im Engagement für die Expressionisten, für Kokoschka, Kirchner und Marc, nach einigem Zögern auch für Beckmann - der im Kronprinzenpalais 1932 einen eigenen Raum bekam -, für Dix und Belling, schließlich sogar für junge Künstler wie Baumeister und Nay an der Spitze der modernen Bewegung. Um 1930 überwies er den Impressionismus als nun endgültig historisches Phänomen ins Stammhaus des 19. Jahrhunderts.
Interessanterweise kehrten die Museen nach 1945 zunächst zum Tschudi-Prinzip zurück und feierten den Impressionismus als Auftakt der Moderne. Erst in den letzten Jahrzehnten bettete man ihn wieder ins angestammte 19. Jahrhundert ein. Justi, der Zauderer, hatte sich in den zwanziger Jahren an die Spitze einer ersten Musealisierung der Moderne gesetzt. Doch für eine progressive Linke war er, der eine totale Vergesellschaftung der Kunst nach sowjetrevolutionärem Beispiel fürchtete, nicht fortschrittlich genug. Mit Dadaismus und Konstruktivismus, mit Neuer Sachlichkeit und Surrealismus konnte er sich noch nicht anfreunden.
Justis Modernismus verfärbte sich zeitweise durch den Zeitgeist. In den Texten seiner Sammlungsführer feiert er Hodler, Munch oder van Gogh als germanische Künstler, gibt sich völkerpsychologischen Spekulationen hin oder fabuliert über nordische Seele und germanischen Geist. Justi war, wie Betthausen schreibt, kein früher Gegner oder Warner vor Hitler, er wollte ihm sogar eine Chance einräumen. Aber anders als Max Sauerlandt oder Wilhelm Pinder folgte er ihm nicht, ja brach bald mit ihm angesichts seiner Untaten.
Nach 1945 stellte sich Justi als Generaldirektor (und zugleich Direktor der Nationalgalerie) ohne ideologische Konzessionen in den Dienst der Ost-Berliner Museen. Er, der schon in den zwanziger Jahren eine "soziale Kunstpflege" propagiert hatte, setzte sich jetzt verstärkt für eine Öffnung der Museen für ein breites Publikum und für eine Dezentralisierung der Bestände ein. Bereits 1948 etablierte er wieder eine "Galerie des 20. Jahrhunderts", kümmerte sich um russische Kunst und die deutsch-sowjetische Freundschaft, wehrte sich aber auch gegen eine neuerliche Diffamierung der Moderne durch die Stalinisten. Justi protestierte, drohte mit Rücktritt, verteidigte aber Ost-Berlin gegen Angriffe aus dem Westen und fühlte sich von nach Westen geflüchteten Mitarbeitern verraten. Schmerzlich litt er unter der Teilung der preußischen Sammlungen, aber erlebte 1955 noch die Rückkehr der als Kriegsbeute entführten Kunstschätze aus der Sowjetunion und durfte die Dresdner Gemäldegalerie auf der Museumsinsel glanzvoll präsentieren.
EDUARD BEAUCAMP
Peter Betthausen: "Die Schule des Sehens". Ludwig Justi und die Nationalgalerie.
Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2010. 396 S., geb. 29,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensent Ingo Arend schätzt Peter Betthausens Arbeit über Ludwig Justi (1867-1957), der mit Unterbrechungen über vierzig Jahre lang Chef der Nationalgalerie Berlin war. Er lobt den flüssigen Stil des Werks sowie die gelungene Verbindung von Biografie und Institutionsgeschichte. Ausführlich geht der Rezensent auf die historische Bedeutung und die Leistungen Justis ein, wirft aber auch einen kritischen Blick auf seinen Konservatismus und seine opportunistischen Anwandlungen gegenüber dem DDR-Regime. Besonders hebt er Justis Gelassenheit hervor, mit der dieser Stile kommen und gehen sah.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH