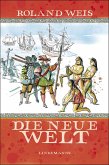Ein großer historischer Roman über das Ende des Zweiten Weltkriegs in Italien
1944 geht der 2. Weltkrieg in Italien viel zu langsam zu Ende. So dauert es auch vier blutige Monate lang, die von den Deutschen besetzte Abtei Montecassino zu erobern. An den Flanken ihres Berges opfern sich Menschen aus aller Welt, doch die ungewöhnlichste Armee dort ist wohl die der Polen: Ihre Soldaten, unter ihnen viele Juden, kommen aus sowjetischen Lagern und gelangten in einer abenteuerlichen Irrfahrt nach Italien, um für Freiheit von Hitler und Stalin zu kämpfen. So auch Samuel »Milek« Steinwurzel, Sohn jüdischer Holzhändler aus der (heutigen) Ukraine, den der Frieden in den Emilio verwandeln wird...
Kunstvoll verbindet Helena Janeczek Orte, Geschichten, Epochen, Schicksale zu einem allumfassenden, berührenden Epos des »italienischen Stalingrad«.
Helena Janeczek wirkt - wie schon 'Das Mädchen mit der Leica' - auch diesen Roman aus ganz unterschiedlichen Erzählsträngen: dem Schicksal eines jungen Texaners. Dem Versuch eines neuseeländischen Studenten zu verstehen, was sein Großvater, ein Maori, in diesem Krieg eigentlich zu suchen hatte. Der Geschichte von Janeczeks eigener Tante, die der Shoah nur entkam, weil die Sowjets sie zur Zwangsarbeit verurteilt hatten. Und den Erlebnissen von zwei Mailänder Abiturienten, die am Soldatenfriedhof von Montecassino Flugblätter verteilen, um nach verschwundenen polnischen Wanderarbeitern zu suchen - aber vielleicht noch mehr nach einem Platz auf der Welt, den sie Heimat nennen könnten.
»Helena Janeczek hat ein unglaublich starkes Buch geschrieben. Darin wird Montecassino zum Krieg von uns allen, zu dem Ort, von dem wir alle kommen.« Roberto Saviano
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
1944 geht der 2. Weltkrieg in Italien viel zu langsam zu Ende. So dauert es auch vier blutige Monate lang, die von den Deutschen besetzte Abtei Montecassino zu erobern. An den Flanken ihres Berges opfern sich Menschen aus aller Welt, doch die ungewöhnlichste Armee dort ist wohl die der Polen: Ihre Soldaten, unter ihnen viele Juden, kommen aus sowjetischen Lagern und gelangten in einer abenteuerlichen Irrfahrt nach Italien, um für Freiheit von Hitler und Stalin zu kämpfen. So auch Samuel »Milek« Steinwurzel, Sohn jüdischer Holzhändler aus der (heutigen) Ukraine, den der Frieden in den Emilio verwandeln wird...
Kunstvoll verbindet Helena Janeczek Orte, Geschichten, Epochen, Schicksale zu einem allumfassenden, berührenden Epos des »italienischen Stalingrad«.
Helena Janeczek wirkt - wie schon 'Das Mädchen mit der Leica' - auch diesen Roman aus ganz unterschiedlichen Erzählsträngen: dem Schicksal eines jungen Texaners. Dem Versuch eines neuseeländischen Studenten zu verstehen, was sein Großvater, ein Maori, in diesem Krieg eigentlich zu suchen hatte. Der Geschichte von Janeczeks eigener Tante, die der Shoah nur entkam, weil die Sowjets sie zur Zwangsarbeit verurteilt hatten. Und den Erlebnissen von zwei Mailänder Abiturienten, die am Soldatenfriedhof von Montecassino Flugblätter verteilen, um nach verschwundenen polnischen Wanderarbeitern zu suchen - aber vielleicht noch mehr nach einem Platz auf der Welt, den sie Heimat nennen könnten.
»Helena Janeczek hat ein unglaublich starkes Buch geschrieben. Darin wird Montecassino zum Krieg von uns allen, zu dem Ort, von dem wir alle kommen.« Roberto Saviano
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
»Janeczek verwebt persönliche Geschichten, Schicksale und historisch Verbürgtes zu einer dichten, spannenden Erzählung.« ORF "ZIB" 20220731
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Montecassino 1944: Fast 80.000 Menschen starben bei den Kämpfen um das Mutterkloster der Benediktiner in Italien. Davon erzählt Helena Janeczek in ihrem Buch, das, so Rezensent Thomas Steinfeld, zum geringeren Teil ein historischer Roman ist. Zwar stehe die weiße Burg auf dem Berg im Mittelpunkt, aber die persönlichen Geschichten der vielen Protagonisten, mache die Lektüre zu einem "Spiel" mit Fiktion und Fakten. Das, merkt der strenge Leser Steinfeld an, geht ihm dann zu weit, wenn die Erzählerin sich in einen Hirsch hineinzufühlen versucht, diesen Krieg aber nur wohlfeil mit Hilfe der Geschichtswissenschaft erklärt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH