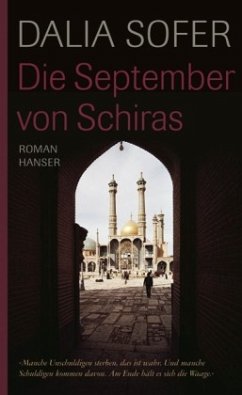1981: Der Ayatollah Chomeini und seine Revolutionswächter haben die Herrschaft übernommen. Am helllichten Tag wird der Juwelier Isaac Amin in seinem Büro von zwei Bewaffneten abgeholt. Im Gefängnis erfährt er, wessen er sich schuldig gemacht hat: Er ist Jude und er ist reich. Während er gefoltert wird, versucht seine Frau, ganz auf sich gestellt, zu überleben ... Spannend und eindringlich beschreibt Dalia Sofer, wie die Umkehrung von Machtverhältnissen die Schicksale von Menschen bestimmen kann. Und sie erzählt auch, wie man überleben konnte im Iran "vor der Revolution".

Eines Morgens wurde Isaac A. verhaftet: Dalia Sofer führt in ihrem Roman "Die September von Schiras" vor, welcher rechtlichen Willkür Juden in Iran ausgesetzt sind.
Millionen Iraner verfolgten vor einigen Monaten mit Spannung eine Seifenoper. Spektakulär an der teuersten Fernsehproduktion des iranischen Staatsfernsehens der letzten Jahre mit dem Titel "Madare sefr darajeh" (auch in der englischen Variante "Zero Degree Turn" bekannt) waren nicht allein die zahllosen Tabubrüche - unverschleierte Frauen, Iraner, die Alkohol trinken und außerehelichen Liebesaffären nachgehen -, als Sensation galt auch, dass über das Medium einer Fernsehserie politische Botschaften kommuniziert wurden, die in scheinbarem Kontrast zur offiziellen Propaganda stehen. Thema der Serie nämlich war die Rettung französischer Juden vor dem Holocaust durch einen iranischen Diplomaten, ein historisch durchaus nicht frei erfundener Tatbestand.
Dabei hat bekanntlich Präsident Ahmadineschad den Holocaust de facto geleugnet und damit die Beziehungen nicht nur zum Westen, sondern auch zu der eigenen jüdischen Minderheit aufs äußerste strapaziert. Das Fernsehdrama diente nun wohl nicht zuletzt dazu, wenigstens im Inneren wieder für etwas Entspannung zu sorgen, ist doch die Islamische Republik Heimat der größten und ältesten jüdischen Diaspora in der muslimischen Welt. Seit fast dreitausend Jahren sind Juden Teil der persischen Kultur. Von den einst hunderttausend Juden haben mehr als drei Viertel das Land in den Jahren nach der Revolution von 1979 verlassen. Nach dem Verhältnis zu den verbliebenen Juden urteilt die Welt nun, ob die iranische Regierung antisemitisch oder doch nur "antizionistisch" genannt werden muss.
Zwar können die iranischen Juden ihre Religion frei ausüben und verfügen über einen Sitz im Parlament, dennoch mussten sie sich seit der Revolution immer wieder mit verschiedenen Formen institutioneller Diskriminierung auseinandersetzen. Positionen im höheren Staatsdienst bleiben ihnen verwehrt, jüdische Schulen unterstehen der muslimischen Schulverwaltung, und Reisen nach Israel zu Verwandten galten lange als Risiko. Im Jahre 2000 erreichte die Situation der Minderheit einen Tiefpunkt: Dreizehn Mitgliedern der jüdischen Gemeinde Teherans wurde in einem Schauprozess unter anderem Spionage für Israel vorgeworfen. Verwandtenbesuche im Heiligen Land wurden ihnen zum Verhängnis. Später kamen die zu zum Teil hohen Gefängnisstrafen Verurteilten auch durch internationalen Druck aber wieder auf freien Fuß.
Ähnlich ergeht es Isaac Amin, einem Juwelier und Paterfamilias aus Teheran, im Romandebüt der heute in New York lebenden Exiliranerin Dalia Sofer. Vom Schreibtisch weg wird er im September 1981 von Revolutionswächtern verhaftet und in ein Gefängnis verschleppt, wo man aus dem bis dahin politisch eher Ahnungslosen ein Geständnis herauszufoltern versucht. Amin ist den Mullahs nicht nur als Jude verdächtig, sondern auch, weil er es mit seiner Arbeit zu ansehnlichem Wohlstand gebracht hat, nicht zuletzt durch Schmucklieferungen an Farah Diba, die Frau des Schahs. Im Gefängnis trifft der Diamantenhändler auf allerlei alte und neue Parias, darunter Anhänger der zoroastrischen Lehre und Kommunisten, obwohl diese die Machtergreifung der Kleriker zunächst als Aufstand der Anständigen gutgeheißen hatten. Während Isaac immer wieder seinem geheimdienstlichen Folterer ausgesetzt ist, einem Typus, der in jedem Terrorregime nur allzu schnell gedeiht, bemüht sich seine Ehefrau Farnaz, ihren verschwundenen Mann ausfindig zu machen und jenseits der Mauern das Leben zu meistern.
Es bleibt existentiell: Der Schwiegervater liegt im Sterben, der leichtlebige Schwager schmuggelt Wodka aus Russland nach Iran, womit er nicht nur sich selbst in Gefahr bringt, und unter den neuen Machtverhältnissen mutieren die einst loyalen Angestellten des Juweliers zu habgierigen Hyänen. Der neunjährigen Tochter Shirin ist eine einzige treue Freundin geblieben, deren Vater ausgerechnet ein Revolutionswächter ist, in dessen Keller sich nicht nur reichlich Schnapsflaschen, sondern auch Dossiers über vermeintliche Staatsfeinde finden. Als sie einige davon verschwinden lässt, um die Bespitzelten, wie sie glaubt, zu retten, hängt das Schicksal ihrer Familie an einem seidenen Faden. Im fernen New York schließlich gehen bei Parvis, dem Sohn der Amins, die finanziellen Mittel zur Neige. Um zu überleben, muss sich der verwöhnte Oberschichtenjunge in einem schäbigen Kellerzimmer einmieten und bei seinem Vermieter, einem orthodoxen Juden, in dessen Hutgeschäft verdingen. Dass sich der säkulare Parvis dabei in die Tochter des strenggläubigen Chassids verliebt, erscheint dem jungen Mann selbst, der der Diktatur der Frömmelei nur um Haaresbreite entkommen ist, als Ironie des Schicksals.
Dalia Sofer verließ Iran 1982 als Zehnjährige und studierte später in den Vereinigten Staaten Literatur und kreatives Schreiben. Das spürt man in jeder Zeile dieses spannenden, aber auch recht schnell konsumierten Buches. Von der Poesie, der Metaphorik, dem Sprachwitz und der oft spröden Eigenwilligkeit der iranischen Literatur ist bei der englischschreibenden Sofer kaum etwas zu spüren. Dafür hält der Leser einen gut konzipierten Roman in der Hand, der sich vom tragischen Auftakt bis zum glücklichen Ende auf dreihundert Seiten langsam zum Bild einer Gesellschaft weitet, in der die Hügel und Täler des Lebens zu Felsen und Schluchten werden. Das Altvertraute, das Gewohnte, auch das Bequeme und Angenehme sind plötzlich dahin, und die Familie gerät in den Strudel der Machtspiele wie einst Dr. Schiwago, der ja auch nur Gedichte schreiben und Kranke heilen wollte. Erzählt wird konsequent im Präsens, in der dritten Person Singular, womit Einblicke in die Psyche der Charaktere gelingen, eine Ehekrise bei den Amins, eine Loyalitätsprüfung bei der Hausdienerin, eine Lebenskrise bei Isaac, dem der Glaube weitgehend abhandengekommen ist und der im glücklichen orthodoxen Familienvater Mendelson, der wie aus den Geschichten Scholem Alejchems entstiegen scheint, einen moralischen Gegenpart bekommt.
Sofer führte für ihren Roman zahlreiche Interviews mit Exiliranern in den Vereinigten Staaten und verarbeitete natürlich auch ihre eigene Geschichte. Man kann es ihr deshalb kaum verübeln, dass Gut und Böse im Buch recht übersichtlich verteilt sind, eher selten werden Zwischentöne hörbar, etwa wenn die muslimische Hausangestellte Farnaz darauf verweist, dass beide Frauen nie Freundinnen auf gleicher Stufe waren, wie es der bedrängten, wohlhabenden Jüdin im Augenblick der Gefahr angenehm wäre, sondern immer Herrin und Dienerin. Isaacs Folterer wiederum, so erzählt ihm ein Gefängniswärter, war einst selbst ein malträtiertes Opfer der Geheimpolizei des Schahs, und Shirins treue Freundin wird nie vergessen, wie sie, das Arme-Leute-Kind, von ihren reicheren Schulkameradinnen geschnitten wurde.
Hin und wieder wäre eine Erklärung hilfreich, etwa, wenn das halbierte Blutgeld für nichtmuslimische Unfallopfer in Iran erwähnt wird, eine Ungerechtigkeit, die unlängst juristisch ad acta gelegt wurde. Eine antisemitische Hetzjagd, das legt auch Sofers Roman nahe, hat es in Iran nicht gegeben. Vielmehr ist die Flucht der Protagonisten ihrer gesellschaftlichen Stellung, der ökonomischen Unsicherheit und den außen- und innenpolitischen Spannungen geschuldet. Wie in nahezu allen Staaten der muslimischen Welt von Marokko bis Usbekistan ist der Exodus der Juden vor allem eine kulturelle Tragödie, das Ende einer jahrhundertealten Symbiose. Dalia Sofer zeigt uns ihre menschliche Dimension.
SABINE BERKING
Dalia Sofer: "Die September von Schiras". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Sabine Roth. Carl Hanser Verlag, München 2007. 325 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Berührt zeigt sich Rezensent Carsten Hueck von diesem Romandebüt über ein jüdisches Schicksal im Iran, den die amerikanische Autorin Dalia Sofer vorgelegt hat. Der Roman über einen verheirateten, glücklichen jüdischen Diamentenhändler, der eines Tages von Revolutionswächtern ohne Angabe von Gründen verhaftet, ins Gefängnis gebracht und lange gefoltert wird, zeichnet sich für ihn durch eine souveräne Schilderung der unterschiedlichen sozialen Milieus und Lebenswelten in der islamischen Republik unter Ayatollah Khomeini aus. Die Schilderung der Verhältnisse im Iran empfindet Hueck als "bedrückend" und bisweilen "kaum erträglich". Zugleich aber attestiert er der Autorin, das menschlich Verbindende hinter der politischen Oberfläche kenntlich zu machen. Besonders lobt er Sofers "ruhigen melodischen Sprachfluss", der von Klarheit und Lebenserfahrung gesättigt sei, und ihre starken, intensiven, aber nie sentimentalen Bilder, die dem Roman eine "suggestive Atmosphäre" verleihen. Beeindruckt hat ihn schließlich die Fähigkeit der Autorin, "ohne dialektische Schablonen" zu zeigen, wie Herren Knechte und die Knechte Herren werden, ohne dass einer Freiheit gewinnt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Durch wechselnde Erzählperspektiven, schriftstellerisches Engagement und wohldosierte Spannungselemente sowie eine überaus abgeklärte, kluge Erzählhaltung entsteht ein vielschichtiges Bild der Familie, deren Aufgabe es ist, einen neuen Platz im Leben zu finden." Jüdische Zeitung, 10.07
"Ein beeindruckendes Debüt." Jonathan Scheiner, Jüdische Allgemeine, 15.11.07
"Ein beeindruckendes Debüt." Jonathan Scheiner, Jüdische Allgemeine, 15.11.07