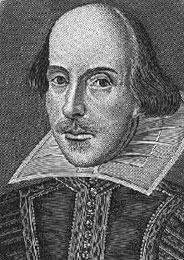"Was man von dem Homer gesagt hat, es lasse sich dem Herkules eher seine Keule, als ihm ein Vers abringen, das läßt sich vollkommen auch von Shakespeare sagen. Auf die geringste von seinen Schönheiten ist ein Stempel gedruckt, welcher gleich der ganzen Welt zuruft: Ich bin Shakespeares! Und welche der fremden Schönheit, die das Herz hat, sich neben ihr zu stellen!" Der das geschrieben hat, war Gotthold Ephraim Lessing, und man kann es als zeitlose Warnung nehmen, sich leichthin an und mit Shakespeare messen zu wollen. Das gilt besonders für zweisprachige Ausgaben, in den die fremde Schönheit ja buchstäblich neben die Shakespeares, so mahnt Lessing, will "studiert", nicht "geplündert" sein. Studiert hat Richard Bletschacher seinen Shakespeare gewiß, jahrzehntelang, gründlich und mit Passion. Und wer seine Übertragungen der Sonette liest, wird feststellen, daß hier ein Übersetzer am Werk war, der sich nicht vor seinen Autor drängelt, ihn nicht modisch aufputzt oder ihm die eigenen Stilmarotten aufpfropft. Bletschachers Übersetzungen sind uneitel, formstreng und wortmächtig; in ihnen verbinden sich handwerkliches Können und poetische Ausdruckskraft.

Von hinkenden Versen und hüpfenden Herzen: Shakespeares Sonette geben dem Übersetzer etwas zu denken / Von Burkhard Müller
Ein Werk, dauerhafter als Erz und höher als die Pyramiden, habe er geschaffen, brüstet sich Horaz - so plump triumphieren Shakespeares Sonette nicht. Ihr Wunsch zu dauern entspringt einem tiefen Erschrecken und begreift sich als einzig möglicher Dienst. Da die Zeit an dem furchtbaren Verbrechen nicht gehindert werden kann, die schöne Stirn des Geliebten mit ihrer Sense zu furchen, so bleibt zur Rettung nichts als das Gedicht: "Wer kann den Raub der Schönheit unterbinden? Ach, niemand, außer vielleicht diesem Wunder: dass meine Liebe in schwarzer Tinte fortfährt zu erstrahlen." Die angestrebte Dauer ist also etwas sehr Zartes; ihr wiederkehrendes Gleichnis ist die Destillation der sommerlichen Rose in ein winziges Gefäß mit Parfüm. Für das eigentümlich Tot-Lebendige solcher Konservierung des Geliebten findet Shakespeare das Bild, es werde in ungeborene Augäpfel eingesargt: das Schneewittchen einer Nachwelt, die zu nichts taugt als zum trauernden Zeugen.
Die Ewigkeit dieser Sonette ist von Glas. Nur mit einiger Gewalt wird man auf sie das gewissermaßen flüssige Konzept von Ewigkeit anwenden können, das der Übersetzungstheorie Walter Benjamins zugrunde liegt. Genau dies tut aber Franz Josef Czernin im Nachwort seiner Neuübersetzung. Zu den Eigenheiten bejaminschen Denkens gehört, dass es, wo es sich in den Händen eines anderen nur um ein Haar vergröbert, sogleich grundfalsch wird. Dass jegliche Sprache nur schmerzlich unvollkommener Abglanz einer vorbabylonischen Ursprache sei und die Übersetzung dem zyklopischen Werk gewissermaßen ein zweites Auge in den Kopf setze, um ihm durch die Parallaxe den Blick in diese Tiefe zu erschließen: Wie leicht macht dieser heikle Gedanke die bestimmte literarische Leistung zum Spielball einer Willkür, die sich im vollen Recht glaubt, nur weil sie später kommt! Was Czernin anrichtet, kann Benjamin, dessen melancholisches Temperament die fremde Spur achtet, unmöglich gemeint haben. Der Vorsatz, die Vergangenheit dem wahrhaft Zeitgemäßen zu erobern, führt in der schlechten Praxis zur Heiligsprechung des Vermittlers. Ganz so, wie Pädagogen und Didaktiker sowohl den Stoff als auch den Schüler enteignen, indem sie frech ihre Lehrstühle zwischen beide pflanzen, so schiebt sich diese Vermittlung zwischen Werk und Leser und beraubt das eine wie den anderen.
Die erste, misstrauische Frage an den, der sich zur Vermittlung anbietet, lautet daher: Wie viel Vermittlung - also: Abänderung - brauchen Shakespeares Sonette? Und man wird feststellen: gar nicht viel. Ihre Gedanken sind klar, ihre Bilder aus modernen Bereichen wie Recht oder Bankenwesen genommen, ihr Metrum ist unmissverständlich; und dann sind sie eben nicht auf Alt-Botokudisch verfasst. Umbildend für die Gegenwart zu gewinnen ist hier nichts. Da aber doch etwas geschehen soll, zerknautscht Czernin Shakespeares nüchterne Sprache zu einer künstlichen Altertümelei, wo es wimmelt von "seim" und "durstes strecke", "erlesen gold" und "geronnen bild". Was könnte verständlicher sein als ein Schauspieler mit Lampenfieber? "Wie ein unvollkommener Schauspieler auf der Bühne, der mit seiner Angst aus der Rolle fällt" - daraus wird bei Czernin: "hinkend ich trete auf, zu voll von zeug, vergleichen / - von herz und maul, die schief einander wild zerreissen". Das heißt wahrlich hinkend aufgetreten. Ein anderes Beispiel: Das Ich reist auf einem Reittier, das seine Trauer ächzend teilt, denn jeder Schritt führt fort vom Freund. Bei Shakespeares, in einer ganz prosaischen, allein dem Informationsgehalt verpflichteten Übersetzung: "Denn dieses Ächzen führt mir vor Augen: mein Kummer liegt vor, meine Freude hinter mir." Bei Czernin jedoch: "denn mit dem ächzen, stöhnen, auf mir stößt, ach zieht: / wo du, mein schönes tier, nicht bist, ist, was mir blüht." Man versteht kein Wort, dunkel sind Sinn, Satzbau, Metrum.
Czernins Metrum stellt den benennbar schlimmsten einzelnen Missgriff dar. Die gattungsstiftende Festigkeit von Shakespeare fünfhebigen Jamben sieht er als unverbindlichen Vorschlag an und bewilligt sich locker selbst eine sechste Hebung. Er fühlt nicht, was sich damit an den Versen in grundsätzlicher Weise ändert. Wie von allein driften sie in die Nähe des Alexandriners, jenes Barockverses, der unter seiner Überlänge in heute meist ungenießbarer Weise an der Mittelzäsur einbricht. Czernins Sechsheber, belastet außerdem mit ungezählten Enjambements, einer aberwitzig vertrackten Syntax und härtesten Tonbeugungen, werden zu einer wackeligen Angelegenheit. Nun mag man einwenden, dass das Deutsche eben länger sei als das Englische und darum mehr Luft einfach brauche. Aber abgesehen davon, dass alle mir bekannten Übersetzungen es geschafft haben, die als formentscheidend empfundene Fünfhebigkeit irgendwie zu wahren: Czernin verschwendet den Zugewinn aufs unsinnigste durch bedeutungslose Verdoppelungen: "wie welle bricht auf welle hart an steinen, küsten", im selben Gedicht: "ach, ob die axt, die sense werden auch geschwungen". Wenn es ein sicheres Stilmerkmal des Barock gibt - jenes Zeitalters also, dem Shakespeares wunderbare Knappheit vorwegnehmend ausweicht -, dann die amorphe Vervielfachung der Glieder. Czernins Tausendfüßlertum weiß nichts davon, dass eine Sense eine Axt bildlich nicht unterstützen kann, dass vielmehr das Eisen der ruhigen regelmäßigen Ernte und das Eisen, das jäh das Wachstum von Generationen niederhackt, einander auf die Zehen treten.
Da der aufgenommene Kredit der sechsten Hebung also für Kinkerlitzchen draufgeht, kommt es dennoch zu Anfällen von Atemnot, die sich vor allem in Unterschlagung des Personalpronomens äußern. Das alles klingt nun so, als wären es lauter einzelne Fehler, die sich vielleicht auch einzeln beheben ließen. Aber es schaukelt sich zum heillosesten und dunkelsten Unfug auf: "ach, wenn du nur erstarrst im eigenen gesicht, / nur eignem sinn verzapft, kommst zum punkt tot, bist nicht." Man weiß wirklich nicht, wo man bei einem solch verfitzten Knäuel ansetzen soll.
Wo es so viel Ärgerliches gibt, sollte man ein erfreuliches Gegenstück nicht unerwähnt lassen: Christa Schuenkes Übersetzung der Sonette von 1994 erscheint jetzt als Taschenbuch. Auch sie macht sich in einem Nachwort Gedanken über das Verhältnis von Urtext und Neufassung; aber der Vorrang des Originals steht für sie unverrückbar fest. Sie lässt sich vom Begriff der "Wirkungsäquivalenz" anspornen, und wo diese gelingt, da sieht sie die höchste Ehre des Übersetzers erreicht. Mit diesem zugleich demütigen und anspruchsvollen Ziel vor Augen vermag sie Unglaubliches. Herausgegriffen sei das 128. Sonett das in seinem schwierigen Akkord aus Sehnsucht, Eifersucht und Übermut die Kunst des Übersetzers auf eine besondere Probe stellt. "How oft when thou, my music, music play'st / Upon that blessed wood whose motion sounds / With thy sweet fingers when thou gently sway'st / The wiry concord that mine ear confounds . . ."
Gottlob Regis hatte daraus im neunzehnten Jahrhundert gemacht: "Wie oft, o meine Muse! wenn dein Finger / Aus dem beglückten Holz Musik entspann / Und jenen Wohllaut, meines Ohrs Bezwinger, / Mit süßem Griff den Saiten abgewann . . ." Das ist solid, obwohl ein wenig fade, wenn die Geliebte, die doch Musik ist, zu einer halballegorischen Muse entschärft wird. Bei Stefan George dann: "Wie oft wenn du, mein klang, die klänge spielst / Auf dem beglückten holz dess regung tönt / Von deiner süßen hand und sanft befiehlst / der drähte einhall der mein ohr umdröhnt . . ." Mangelnde Musikalität macht sich hier aufs empfindlichste bemerkbar, sowohl in der Wortwahl, die die Harmonie zum fragwürdigen "Einhall" verdeutscht und Kammermusik nur als ein Dröhnen wahrnimmt, als auch in der Form, deren interpunktionslose Starrheit nur noch wie eine verbohrte Marotte erscheint. Ganz zu Recht tadelt ihn hierfür Karl Kraus. Aber auch sein Gegenvorschlag bleibt eigentümlich matt: "Wie oft, wenn deine lieben Finger leihen / dem toten Holze der Befühlung Glück / und lassen ihm die Wohltat angedeihen, / die meinem Ohr zuteil wird als Musik . . ." Der verfügbare knappe Raum wird von ausgreifenden Redewendungen aufgezehrt, die für Subtilitäten - es ist Musik, die hier Musik macht - nichts mehr übrig lassen. Schweigen wir von dem, was Czernin liefert - dem es doch gerade dieses Sonett angetan zu haben scheint, denn seiner "Übersetzung", in der das Original schon nur mit Mühe wiederzuerkennen ist, schiebt er noch eine "Übertragung" völlig veränderten Inhalts nach, ein Gebilde, "nur eignem Sinn verzapft", bei dem man sich fragt, warum er daran noch das Namensschild Shakespeares anbringt.
Diese Versuche muss man gesehen haben, um zu ermessen, was Christa Schuenke leistet: "Wenn du, Musik, mich mit Musik belebst / Auf dem verwünschten Holz, das bebt und girrt, / Wenn du mit süßen Fingern sachte webst / Den drahtnen Einklang, der mein Ohr verwirrt, / Beneide ich die Springer, wie sie wippen / Und küssen eifrig deine zarte Hand, / Wie sie die Ernte rauben meinen Lippen, / Und bin von ihrer Keckheit übermannt!"
Übersetzungen scheinen sich ja immer in dem betrüblichen Dilemma zu befinden, dass der Grad ihrer Treue mit wachsender Schönheit abnimmt. Diese Version aber verdankt ihre Schönheit gerade der Treue, die sie Shakespeare hält und die sich als ein Wagnis zu erkennen gibt, welches ihre Vorgänger nicht eingehen mochten. Niemand sonst hatte an den Draht gerührt, der in die Harmonie eine ungebührliche Schärfe zu bringen schien: Schuenke tut es und hat mit einem Griff das Prekäre und das Historische dieses Klangs in der Hand: statt eines unbestimmten Saitenspiels (oder gar des monströsen Flügels, den Czernin glaubt ins Wohnzimmer zwängen zu müssen) ertönt in metallischer Behutsamkeit das Klavichord, das hier zweifellos gemeint ist. Man weiß wahrlich nicht, ob man Christa Schuenke mehr bewundern soll für das, was sie kann, oder rühmen für das, was ihr geglückt. Und es ist tröstlich, dass im selben Augenblick, wo sich die möglicherweise schlechteste Sonnets-Übersetzung aller Zeiten hervortraut, auch die vielleicht beste in einer preiswerten Ausgabe zugänglich wird.
William Shakespeare / Franz Josef Czernin: "Sonnets / Übersetzungen". Hanser Verlag, München 1999. 139 S., br., 29,80 DM.
William Shakespeares: "Die Sonette". Zweisprachige Ausgabe. Neu übersetzt von Christa Schuenke. Mit einem Essay und Literaturhinweisen von Manfred Pfister. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1999. 196 S., geb., 16,90 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main