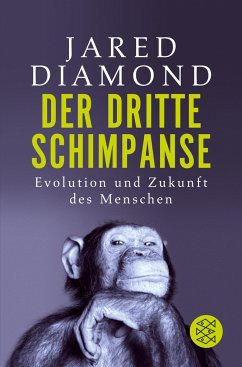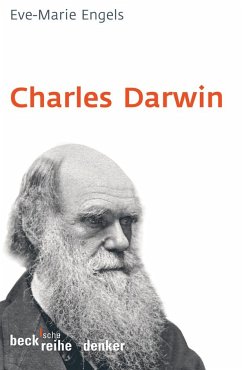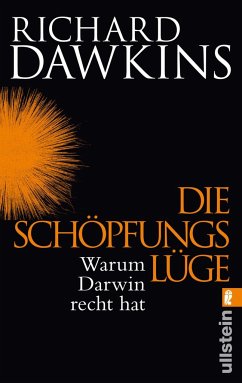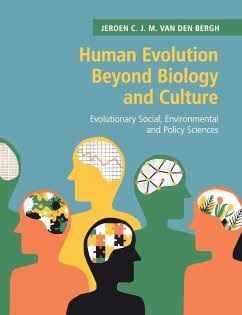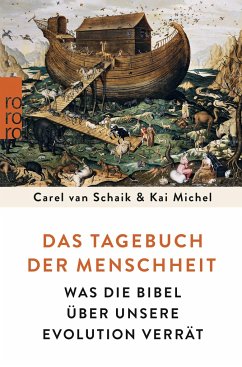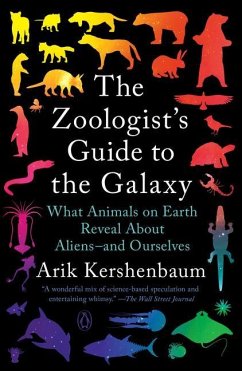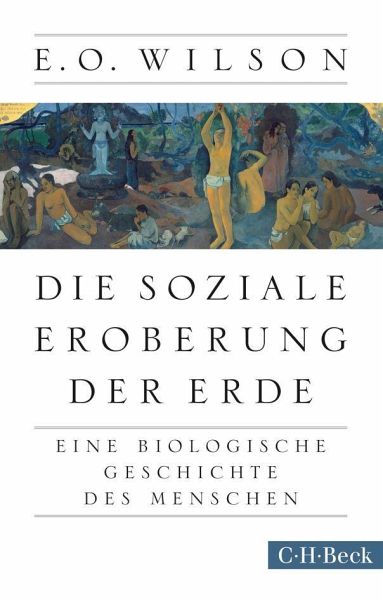
Die soziale Eroberung der Erde
Eine biologische Geschichte des Menschen
Übersetzung: Ranke, Elsbeth

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Egoismus oder Nächstenliebe, Eigennutz oder Kooperation was liegt mehr in der Natur des Menschen? Als Einzelwesen sind wir egoistisch, als Gruppenwesen aber ziehen wir uneigennütziges Verhalten vor, sagt Edward O. Wilson, der berühmteste Biologe unserer Zeit. Zwischen den beiden Antriebskräften herrscht ein Dauerkonflikt, in der Gesellschaft wie in jedem Einzelnen von uns. Die Balance, die wir anstreben, ist stets zerbrechlich. Die soziale Eroberung der Erde ist die Summe lebenslanger innovativer Forschung, die Krönung des Lebenswerkes von Edward O. Wilson.