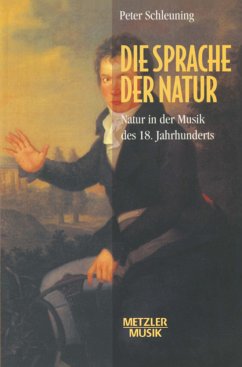Peter Schleuning folgt ihren Spuren von Bach bis Mozart
Während in der Kunstwissenschaft sich kaum jemand für formale Analysen in der Tradition Wölfflins interessiert, die ikonographische Sinnsuche das Feld beherrscht, steht in seltsamer Ungleichzeitigkeit die musikalische Semantik ganz am musikwissenschaftlichen Rande. Dort entfaltet sie um so hektischere Aktivitäten. Unter Beweisdruck zieht sie sich auf das Beweisbare zurück, und das ist meist das Uninteressanteste. Die Zahl der Themeneinsätze bei Bach, versteckte Liedzitate bei Schumann - sie mögen Hinweise auf die Intention des Komponisten geben, zur Erscheinung des Kunstwerks gehören sie als private Geheimnisse nicht.
Anders verhält es sich schon mit den barocken Figuren, mit der symbolischen Textauslegung. Ein noch so kleines Choralzitat wird im lutherischen Raum als sinnvoll wahrgenommen worden sein. Und anders verhält es sich mit den Stilgattungen. Noch Brahms hält zwar nichts von der romantischen Idee poetischer Musik, dennoch schreibt er keine absolute Musik als reine tönend bewegte Form. Er operiert mit Gattungen wie dem Idyllischen, dem Heroischen, und er transformiert diese Gattungen. Sein bildungsbürgerliches Publikum wird hier auf genus und differentia specifica reagiert haben, wo heute selbst der verbissenste Feind moderner Kakophonie "abstrakt" hört.
Die Musikwissenschaft könnte zur Aufgabe haben, den Reichtum des Sinns im Gehörten zu erschließen. Da dieser Sinn bei neuen Hörern wieder ein neuer ist, wäre sie als interpretierende Wissenschaft vor allen Grundlagenkrisen gefeit. Aber sie interpretiert nicht, sie subsumiert. Die Analyse betrachtet tonale Schemata und motivische Ableitungstechniken. Und die Semantik identifiziert Topoi. Glücklich, bei Bach eine Kreuzesfigur ausfindig gemacht zu haben, fragt der Semantiker nicht nach dem Sinnzusammenhang, den der Topos eröffnet. Mit Bienenfleiß dokumentiert er die Geschichte des Heroischen im Abendland, ohne daß man erführe, was Brahms nun damit macht. Auch Peter Schleuning schleppt tonnenweise Zitate zum Naturverständnis im achtzehnten Jahrhundert heran, mit kaum mehr als dem ganz unbezweifelbaren Resultat, daß in der Empfindsamkeit der authentische Ausdruck die einfache Nachahmung der Natur ablöst.
Klüger wäre gewesen, er hätte die Geschichte der Pastorale als Art des Idyllischen, um die es hinter der spanischen Wand des Titels eigentlich geht, ins siebzehnte und neunzehnte Jahrhundert ausgedehnt (nicht zuletzt hätte ihn das Vorsicht gegenüber der Identifikation: Schäfer beziehungsweise Schafe gleich aufstrebendes Frühbürgertum gelehrt). Diverse Werke werden als verkappte Pastoralen ausgemacht. Bach und Mozart seien herausgegriffen. Bei den herandrängenden Klangmassen, die am Anfang der Johannespassion in den Ausruf "Herr" münden, bräuchte es einigen barocken Witz, um an Lämmer zu denken. Plausibel dagegen wird auf Orgelpunkt, Dreiklangsbrechungen, Imitatorisches, Ungradtaktigkeit, Tonart der F-Dur-Toccata hingewiesen. Der triumphale Baßabstieg, eine der gewaltigsten Eingebungen des jungen Bach, wäre dann als Bildsymbol für das Hinabsteigen des Heilands zu nehmen. Diesen Abstieg begleiten musikalische Kühnheiten. Nur in einer Situation aber löse Christus Schrecken und Verwirrung aus, bei der Verkündigung an die Hirten (wie steht es um das jüngste Gericht?). Die abschließende Befriedung müsse deshalb das Auffinden des Kindes in der Krippe meinen.
Eine falsche Pastorale sei der zweite Teil des Duettes Don Giovanni / Zerlina. Synkopierung und Chromatik gehören nicht in die Gattungstradition. Musikalisch richtig sei der Siciliano-Schluß des Versöhnungsduettes Zerlina / Masetto. Hier dagegen passe Zerlinas Unehrlichkeit nicht zur Musik, auch gehöre das Pastorale zum dritten, bürgerlichen, nicht zum vierten Stand. In beiden Fällen setze Mozart den Topos in einer neuen Reflexivität ein zur "Entlarvung erlogener und überlebter gesellschaftlicher und zwischenmenschlicher Harmonie". Aber drücken Chroma und Synkope nicht Schmachten und erotische Eile aufs trefflichste aus? Machen die Frauen das nicht alle so? Und können nicht schon bei Bach Synkopen den falschen Schein der Erdenpracht entlarven?
Schleuning nimmt das Siciliano als Art der Pastorale, wobei der glatte Rhythmus eher geistlich, die Punktierung des Siciliano eher weltlich zu verstehen seien. Der tieftraurige langsame Satz des A-Dur-Klavierkonzertes KV 488 vereine beide Typen. Im Orchesternachspiel verschwindet die Siciliano-Punktierung der Klaviermelodie. Das bedeute "einen Übergang zur Sphäre des Höheren". Auch das Imitatorische, die Überbindungsvorhalte, Kennzeichen des Kirchenstils, bestätigen "den Eindruck von überirdischer Weihe". Wer da überirdische Weihe hört, sollte vielleicht den Dirigenten wechseln.
Dennoch ist an der Deutung etwas dran. Die Zerrissenheit des Klavierparts weicht einer fast regungslosen Klage, die wie ein Gebet aus tiefsten Nöten wirkt. Der Geschichte religiöser Gesten bei Mozart, dem Bitten, Danken, Loben wäre einmal nachzugehen. Nur warum soll diese Passage denn pastoral sein? Daß Pastorale und Siciliano sich wie geistlich und weltlich zueinander verhalten, bricht doch schon unter dem Blick auf das berühmteste Siciliano zusammen, die Erbarme-Dich-Arie der Matthäuspassion.
Schleuning überzieht seine Identifikationen. Wo Mozart nur pastorale Momente benutzt (und dann des Schäfers Klagelied zu einem steinerweichenden Gebet vertieft), sieht Schleuning das ganze Stück als Repräsentanten des Typus und muß dann in den Abweichungen einen komplizierten Sinn suchen: Das La ci darem la mano klinge falsch. Wo Bach ein einfaches Bild umsetzt, malt Schleuning die Details aus. Es reicht nicht, daß der Mensch vor dem Göttlichen zurückschreckt wie die Schafe vor dem Gewitter oder die Hirten vor dem Engel des Herrn, am Ende muß noch das Kind in der Krippe zu sehen sein.
Teils sind das individuelle Übertreibungen. Die Katabasis der F-Dur-Toccata ähnelt dem Gewitter aus Beethovens Pastorale. Beethoven kann Bachs Stück gekannt haben. Kaum aber dürfte er "auf der Suche nach Bachs Absichten geschlossen haben: Wenn der erste Toccatenteil auf die friedliche Natur gemünzt war, so mußte der zweite die aufgewühlte Natur vertreten". Denn man stelle sich einmal vor, Schleuning hätte Beethoven über seinen Fehler aufklären können, hätte dann die Gewitterszene umkomponiert werden müssen? Und warum eigentlich soll nicht auch bei Beethoven Gott sich im Gewitter zeigen? Völlig abstrus wird die Sache, wenn die Erfahrung des Erhabenen in der Natur mit Berichten über Schneekoppebesteigungen belegt wird - und die Vermutung folgt, daß auch Bach den Berg erklommen haben könnte. Fehlte nur noch, daß er am Anfang der Matthäuspassion zu sehen ist.
Der Beziehungswahn ist indes bei Semantikern so ausgeprägt, daß ein Prinzip dahinter stehen mag. Sie denken, darin wahres Pendant der Ikonographen, musikalische Bedeutung nach dem Vorbild sprachlicher Bedeutung (von der sie obendrein ein philosophisch unzureichendes Verständnis haben). Ihr Ideal wäre ein Lexikon, das Eins-zu-eins-Übersetzungen von Musik ermöglichte. Aber Sinn erhalten die Topoi, Typen, Gattungen erst im Werkganzen. Wie musikalisches Sinnverstehen jenseits der Dichotomie von formaler, syntaktischer Analyse und übersetzender Semantik aussehen könnte, deutet Schleuning zumindest an, wenn er die symmetrischen Formen der Klassik mit dem Vertrauen auf eine vernünftig geordnete Natur in Verbindung bringt. GUSTAV FALKE
Peter Schleuning: "Die Sprache der Natur". Natur in der Musik des achtzehnten Jahrhunderts. Metzler Verlag, Stuttgart 1998. X, 230 S., zahlreiche Notenbeispiele, geb., 58,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main