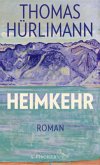»Tornado« hieß das Kino damals, unten am Fluss. Alle erinnern sich noch an den alten Schuppen mit den Klappstühlen. An die Leinwand, auf der Filme mit Marilyn Monroe und Grace Kelly liefen. Und an die Nacht, als das Kino dann von der Polizei geschlossen wurde. An den Protestzug des wütenden Publikums, die Straßenschlacht. Wie ein Schatten liegt die Erinnerung auf der Stadt in der Ebene, nicht weit vom Meer. Maria war damals wie viele andere dabei. Und auch ihr Freund Ramiel, der als Polizist plötzlich auf der anderen Seite stand und den Projektor im Kino zerstörte. Heute ist sie Lehrerin und erzählt ihren Schülern immer wieder die Geschichte des Königs von Reval und Riga: Wie er in tiefem Schmerz durch die Wälder und Wüsten zog, um seine große Liebe zu vergesssen, und wie er auf seiner Wanderung die Sprache der Sonne, des Mondes und des Regens lernte ...
In seinem zweiten Roman nimmt sich Roland Schimmelpfennig alle Freiheiten des Erzählens und entführt uns in eine Welt voller magischer Geschichten über Liebe, Familie und Verrat.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
In seinem zweiten Roman nimmt sich Roland Schimmelpfennig alle Freiheiten des Erzählens und entführt uns in eine Welt voller magischer Geschichten über Liebe, Familie und Verrat.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Ein verspielter und präziser, verführerischer und beunruhigender Text von einem sich klug zurückhaltenden Autor. Carsten Hueck Österreichischer Rundfunk 20171203

Der Theaterautor als Traumbildarrangeur: Roland Schimmelpfennig betreibt in seinem Roman "Die Sprache des Regens" Stimmungsarbeit.
Von Simon Strauß
Letztes Mal flüchtete ein junges Landliebespaar in die Großstadt, wurde ein stummer Bauarbeiter betrogen, verlor ein Späti-Besitzer den Verstand, lag ein toter Jäger im Schnee, brannte ein Feuer in der Winternacht, schnitt ein halbnackter Greis im Kerzenschein Fleischwurst. In Roland Schimmelpfennigs 2016 erschienenem Debütroman mit dem coverbrechenden Titel "An einem klaren, eiskalten Januarmorgen zu Beginn des 21. Jahrhunderts" gab es keine Rahmenhandlung, keine rotfädige Erzählung, sondern nur unverbundene Momentaufnahmen, zersplitterte Short Cuts. Und einen einsamen Wolf, der als heimlicher Spielleiter immer wieder durchs Bild lief.
Auch in Schimmelpfennigs neuem Roman, "Die Sprache des Regens", gibt es wieder einen Vierbeiner, einen streunenden strohfarbenen Hund, der schon auf den ersten Seiten mit einer Eisenstange brutal erschlagen wird. Warum? Der Autor hält sich nicht auf mit sinnstiftenden Erzählungen. Gezeigt wird ja kein Tafel-, sondern ein Traumbild. Deswegen geht es allein darum anzudeuten, Atmosphäre zu schaffen. Dafür werden diesmal sogar noch weniger Erzählfäden gesponnen als beim letzten Mal.
Durchgehend schimmert das Rätsel durch, die Bilder sollen für sich sprechen: Ein Junge hat Fieber, ein Kino schließt, eine Lehrerin wandert in den Knast, Zwillinge sterben, die Umrisse einer dunklen Stadt ziehen auf dem Meer vorbei. Eine junge Frau erhängt sich, ein trauriger Bahnarbeiter betrinkt sich, ein fett gewordener Musiker erinnert sich an vergangene Zeiten. Und irgendwann taucht auch noch kurz ein alter Gerichtspräsident auf.
Schier endlos scheint die Zahl an Personen, die Schimmelpfennig auftreten lässt. Sie kommen und gehen, ohne wirklich etwas zu bedeuten. Zeit für eine eigene Geschichte, eine Haltung, einen Charakter bekommen sie nicht. Sie bleiben Staffage, Hintergrund eines apokalyptischen Settings, in dem überall Kerzen brennen und Straßenkämpfe ausbrechen, weil ein altes Filmtheater geschlossen wird.
Eigentlich steckt eine großartige Geschichte in dieser Kino-Szene: Ein Aufstand der Bevölkerung gegen die rüde Entsinnlichung der Welt, ein verzweifeltes Aufbegehren für die Filmkunst, der vom Funktionsstaat blutig niedergeschlagen wird. Aber davon zeigt Schimmelpfennig nichts. Er skizziert nur, schreibt in einer feingliedrig klaren Sprache, ohne wirklich erzählen zu wollen. Man schlägt die durch viele weiße Leerstellen seltsam stilisiert wirkenden Buchseiten um und wartet begierig auf einen entscheidenden Moment. Einen Hinweis, worum es geht, wohin der Autor uns führen will. Aber die Hoffnung bleibt unerfüllt. Träume lassen sich nicht in eine narrative Struktur einpassen, soll das wohl heißen. Müssen verschwommen und unerklärt bleiben. Vielleicht. Aber gerade das undeutlich Schummrige muss doch, um richtig zu wirken, besonders genau kalkuliert sein.
Der als Theaterautor erfolgreiche Schimmelpfennig hat einmal gesagt, Geschichten ohne Geheimnis seien ihm "ein Greuel". In seinen - unterschiedlich nuancierten - Stücken versucht er immer wieder, Rätselwelten auf die Bühne zu bringen, alltägliche Liebesmomente oder Politszenen ins Surreale kippen zu lassen und der schnöden Realismuserwartung des Publikums ein Schnippchen zu schlagen. Stücke wie "Fisch um Fisch", "Vor langer Zeit im Mai" oder das (zuletzt in Mannheim uraufgeführte) "Große Feuer" leben von einer besonderen, unzeitgemäßen poetischen Melancholie.
Als Prosaerzähler hat Schimmelpfennig denselben ernstzunehmenden Anspruch: Er will das Geheimnisvolle, den Traum ins Zentrum rücken. Aber beim Lesen von "Die Sprache des Regens" überwiegt am Ende doch das schale Gefühl einer andauernden Textüberladung: zu viel Ahnung, zu viel Andeutungen, zu wenig innerliche Schärfe.
Offenbar will der Prosaist Schimmelpfennig das, was er sich als Dramatiker verbieten muss - die Personen unkonturiert lassen, Stimmungs- und Spannungsgesetze missachten, Szenen absichtsvoll wiederholen -, hier ganz ausleben. Er präsentiert einen unübersichtlichen Milieu-, Personen- und Geschehenswirrwarr. Dauernd wechseln Ort, Zeit und handelnder Protagonist. Um die Verwirrung noch zu steigern, sind immer wieder Fragmente aus einer alten Sage um den König Vadim von Reval und Riga dazwischengeschnitten. Der war so heftig in die Königin von Kastilien verliebt, dass er zu ihr nicht nur quer über den Globus reiste, sondern sich auch unter Baumwurzeln verkroch, um dort die Sprache der Steine, Blätter und des Regens zu lernen.
Interessanterweise ist Schimmelpfennigs Buch in seinen naturlyrischen Momenten am unprätentiösesten und wirkungsvollsten: "Die Steine sprechen fast nur in Vergangenheit. Sie sprechen von Ewigkeit und Alter und Stillstand. Sie erinnern einander daran, dass sie einmal etwas anderes waren als kalte Steine. Wenn die Steine aber versuchen, von der Zukunft zu sprechen, gehen ihnen die Wörter aus. Sie können sich keine Zukunft vorstellen, sie können darüber nicht sprechen, nur schreien, brüllen, und dann zerbersten sie manchmal." Vielleicht fällt das Schreiben über Träume und Ahnungen angesichts eines naturwüchsigen Geheimnisses besonders schwer. Wenn Steine sprechen können, gehen uns die Worte aus.
Roland Schimmelpfennig: "Die Sprache des Regens". Roman.
Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 2017. 320 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main