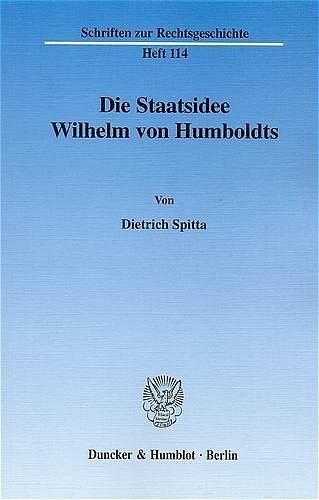
Die Staatsidee Wilhelm von Humboldts.
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
39,90 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Humboldts grundlegende politische Ideen, die er als preußischer Staatsmann entwickelt, aber selbst nicht systematisch dargestellt hat, sind bisher wenig bekannt. Denn es gibt bisher von seiner Staatsidee keine zusammenfassende Darstellung.Berühmt, aber inhaltlich wenig beachtet, ist seine Jugendschrift über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates. Darin behandelt er das aktuelle Thema der Begrenzung der Staatsmacht und der Selbstverwaltung des geistigen und wirtschaftlichen Lebens. Erfüllt von der tiefsten Achtung vor der menschlichen Individualität ging es ihm darum, Freiheitsräume für...
Humboldts grundlegende politische Ideen, die er als preußischer Staatsmann entwickelt, aber selbst nicht systematisch dargestellt hat, sind bisher wenig bekannt. Denn es gibt bisher von seiner Staatsidee keine zusammenfassende Darstellung.
Berühmt, aber inhaltlich wenig beachtet, ist seine Jugendschrift über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates. Darin behandelt er das aktuelle Thema der Begrenzung der Staatsmacht und der Selbstverwaltung des geistigen und wirtschaftlichen Lebens. Erfüllt von der tiefsten Achtung vor der menschlichen Individualität ging es ihm darum, Freiheitsräume für die Entwicklung und Entfaltung der Menschen in ihrer individuellen Mannigfaltigkeit zu schaffen. Von dieser Schrift wird behauptet, Humboldt habe später seine Jugendideen aufgegeben und als preußischer Staatsmann diesen zuwider gehandelt. Spitta weist nach, daß diese Meinung unzutreffend ist. Im Gegenteil: Als Staatsmann versuchte Humboldt, seine Ideen über die Grenzen des Staates so weit wie möglich zu verwirklichen.
In seinen zahlreichen politischen Schriften hat Humboldt eine Fülle wichtiger und auch für die heutige Zeit anregender und fruchtbarer Ideen entwickelt; so insbesondere über die Mitwirkung der Bürger am staatlichen Leben, über die Organisation der Regierung und der staatlichen Behörden, über die deutsche Verfassung und über Deutschlands Stellung in Europa. Die bedeutsamen Ideen Humboldts über die Verwirklichung seiner Staatsidee schließen die Darstellung ab. Sein Biograph Friedrich Schaffstein zählte Wilhelm und Alexander von Humboldt »zu den hervorragendsten Repräsentanten deutscher und europäischer Geistigkeit«. Angesichts der heutigen Perspektivlosigkeit können Humboldts Ideen, insbesondere seine grundlegende Idee von den Grenzen der Wirksamkeit des Staates, wegweisend sein.
Berühmt, aber inhaltlich wenig beachtet, ist seine Jugendschrift über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates. Darin behandelt er das aktuelle Thema der Begrenzung der Staatsmacht und der Selbstverwaltung des geistigen und wirtschaftlichen Lebens. Erfüllt von der tiefsten Achtung vor der menschlichen Individualität ging es ihm darum, Freiheitsräume für die Entwicklung und Entfaltung der Menschen in ihrer individuellen Mannigfaltigkeit zu schaffen. Von dieser Schrift wird behauptet, Humboldt habe später seine Jugendideen aufgegeben und als preußischer Staatsmann diesen zuwider gehandelt. Spitta weist nach, daß diese Meinung unzutreffend ist. Im Gegenteil: Als Staatsmann versuchte Humboldt, seine Ideen über die Grenzen des Staates so weit wie möglich zu verwirklichen.
In seinen zahlreichen politischen Schriften hat Humboldt eine Fülle wichtiger und auch für die heutige Zeit anregender und fruchtbarer Ideen entwickelt; so insbesondere über die Mitwirkung der Bürger am staatlichen Leben, über die Organisation der Regierung und der staatlichen Behörden, über die deutsche Verfassung und über Deutschlands Stellung in Europa. Die bedeutsamen Ideen Humboldts über die Verwirklichung seiner Staatsidee schließen die Darstellung ab. Sein Biograph Friedrich Schaffstein zählte Wilhelm und Alexander von Humboldt »zu den hervorragendsten Repräsentanten deutscher und europäischer Geistigkeit«. Angesichts der heutigen Perspektivlosigkeit können Humboldts Ideen, insbesondere seine grundlegende Idee von den Grenzen der Wirksamkeit des Staates, wegweisend sein.












