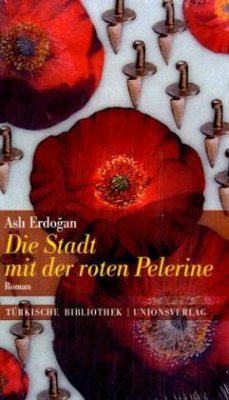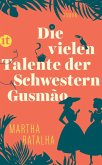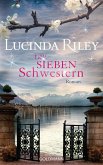Rio de Janeiro: Stadt des Karnevals, Meisterin im Spiel der Täuschungsmanöver, der Zufälle und der Maskerade. Özgür, eine introvertierte junge türkische Akademikerin, kann sich von der ebenso faszinierenden wie bedrohlichen Stadt nicht lösen, ja sie fühlt sich vielmehr angezogen von der scheinbar grenzenlosen Freiheit und der Lebensfreude der brasilianischen Metropole. Weit entfernt hat sich dabei die junge Frau von der traditionellen Frauenrolle, wie sie die türkische Gesellschaft vorsieht. Nicht wie eine Touristin führt Özgür den Leser durch die Labyrinthe dieser Großstadt, sondern wie eine Migrantin, die das zunächst Fremde als Vertrautes und Eigenes akzeptiert. Gleichzeitig ist die Stadt Impuls für ihr Schreiben und für die Schöpfung ihrer fiktiven Doppelgängerin Ö. - die beiden Erzählebenen, auf mannigfache Weise miteinander verflochten, spiegeln sich ineinander. Passagen, die aus einem Reiseführer stammen könnten, folgen surrealen Szenen, satirische Momente wechseln sich mit Zeitungsmeldungen ab. Die Reise in die Straßen Rio de Janeiros, immer begleitet von brasilianischen Rhythmen, führt mitten hinein in die Tiefen der Stadt mit ihren aufmüpfigen Favelas. Atemberaubend ist die nuancierte Feinzeichnung der Menschen, die in Liebe und Leid auf oftmals tödliche Weise miteinander verschmelzen.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Monika Carbe hat Asli Erdogans Roman um die junge aus Istanbul stammende Özgür, die sich in der Metropole Rio de Janeiro durchzuschlagen versucht und schrittweise in ihrer Einsamkeit ihre Identität verliert, nicht kalt gelassen. Die Protagonistin protokolliert in ihrer Romankladde, deren Heldin ihr alter Ego Ö. ist, die Eindrücke von Gewalt, Armut und Verlorenheit wobei ihre Aufzeichnungen immer "verstörender" und "verstörter" werden, stellt die Rezensentin mitgenommen fest. Der erschütternde Eindruck mag sich auch aus der Tatsache ergeben, dass die türkische Autorin, die Informatik und Physik studiert hat, die fortschreitende Auflösung ihrer Heldin bei aller Poesie und aller Bilderfülle recht analytisch und kühl beobachtet, mutmaßt Carbe. Höchst begrüßenswert findet die Rezensentin, dass mit diesem Roman, der in die seit 2005 erscheinende 20-bändige Türkische Bibliothek des Zürcher Unionsverlags aufgenommen worden ist, "endlich einmal" eine türkische Autorin zu Wort kommt, die ihre Protagonistinnen ein modernes, unabhängiges Leben führen lässt, und wenn es noch so furchtbar ist.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Ein großes Stück Weltliteratur, eine teilweise autobiografische und doch universale Geschichte von traumatisierten Menschen - jenseits der Grenzen der Türkei, Brasiliens oder Europas.« Günter Wallraff