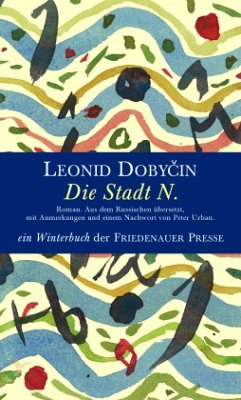Produktdetails
- Winterbuch
- Verlag: Friedenauer Presse
- 2. Aufl.
- Seitenzahl: 226
- Erscheinungstermin: 2. November 2009
- Deutsch
- Abmessung: 206mm x 128mm x 21mm
- Gewicht: 322g
- ISBN-13: 9783932109614
- ISBN-10: 3932109619
- Artikelnr.: 26335496
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Der Mann, den die Kritiker "Monster" nannten: Leonid Dobycins aufregend ruhiger Kleinstadtroman von 1935.
Von Tilman Spreckelsen
Vielleicht ist es an der Zeit, sich endlich mit Dünaburg an der Düna vertraut zu machen, der Stadt, die heute Daugavpils heißt und im südlichsten Lettland liegt, auf der Grenze zwischen Livland und Kurland. Glaubt man den Fotos, dann ist vom einstigen bürgerlichen Glanz der Garnisonsstadt nicht mehr viel übriggeblieben, nur verblasst diese Gewissheit, wenn man Leonid Dobycins Roman "Die Stadt N." aufschlägt und Absätze liest wie diesen: "Eines Sonntags waren wir im Feuerwehrgarten. Schmetternde Walzer ertönten dort, und Feuerwehrmänner hüpften in Säcken um die Wette. An die Kinder verteilte man Papierfähnchen und ließ sie antreten. Militärisch schritten Serge und ich in den Reihen. Wie aus dem Eisenbahnzug sahen wir über dem Platz die Bäume und das Laub, das von ihnen abfiel. Der Ingenieur lobte uns. - Das Marschieren ging doch sehr hübsch, - sagte er."
Wie der Ich-Erzähler dieses schmalen Romans wuchs Dobycin, geboren 1894 in Ludza an der lettisch-russischen Grenze, als Sohn eines Arztes in Dünaburg auf. Sein Vater starb früh, die Familie verarmte, Dobycin wurde nach dem Weltkrieg Statistiker im russischen Brjansk, wo er bis 1934 blieb, einige Erzählungen verfasste und seinen Roman "Die Stadt N." begann. Am 25. März 1936 musste der mittlerweile in Leningrad wohnende Autor auf einer Diskussionsveranstaltung erleben, wie sein kurz zuvor erschienener Roman als "zutiefst feindliches Werk" bezeichnet wurde, er selbst als "Monster", und nachdem er fluchtartig den Saal verlassen hatte, verliert sich seine Spur, endgültig: Ein Leichnam wurde nie gefunden.
Was so "feindlich" ist in dem Buch, erschließt sich schnell: Geschildert wird in meisterlich reduzierten, in sich abgerundeten Absätzen das Leben in einer mittelgroßen Stadt aus den Augen eines Kindes. Das ist sehr viel, denn alles hat hier eine ungeheure Bedeutung, alles ist existentiell, der Besuch in der Buchhandlung ebenso wie die Gespräche mit dem vertrauten Freund Serge, die Begegnung mit der wissbegierigen Bekannten wie die paar Worte, die ein Vorübergehender fallen lässt, und ganz fern hört man vom Krieg mit Japan. Und es ist wenig, wohl zu wenig in den Augen derer, die darin eine ordentliche Kritik am Kleinbürgertum ebenso vermissen wie die Parteinahme für das Wetterleuchten der Revolution.
Was fängt man auch mit einem Erzähler an, der sich schon früh abgeklärt in die Dinge schickt? "Serge sagte mir später, er habe sich geschworen, seinen Vater zu rächen. Ich drückte ihm die Hand und mochte ihm nicht sagen, dass sich zu rächen sehr schwierig sei." Wenn er dann doch einmal aktiv wird, greift der Knabe zu Mitteln, die unter Stalin höchst dubios erscheinen: "Ich wollte von dem Mönch erfahren, ob Gott wohl zustimmen würde, jemanden in die Hölle zu stecken, wenn man nur ordentlich darum betete. Das misslang, weil unsere Regimenter zurückkehrten, und die, die sie ersetzen sollten, abrückten, und der Mönch rückte mit ihnen ab."
Es ist diese sanfte Verweigerung, die jede Zeile des Romans atmet, das Staunen über eine Welt im Mikrokosmos von Dünaburg, die einem sensiblen Kind so viel an Augenaufreißen abnötigt, dass für mehr keine Energie mehr übrig ist. Was es später den völlig isolierten Autor gekostet haben wird, diesen Blick aus der Rückschau neuerlich heraufzubeschwören, kann man nur ahnen. Wie staunenswert leicht aber sein Text daherkommt, lässt sich dank Peter Urbans Übersetzung nun entdecken.
Leonid Dobycin: "Die Stadt N.". Roman. Aus dem Russischen und mit einem Nachwort von Peter Urban. Friedenauer Presse, Berlin 2009. 226 S., geb., 22,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Tilman Spreckelsen stellt Leonid Dobycins 1936 publizierten Roman "Die Stadt N." vor, der dem Autor in der stalinistischen Sowjetunion scharfe Kritik eingetragen hatte. Nach einer Diskussionsveranstaltung, bei der sein Roman als "zutiefst feindlich" verurteilt und Dobycin persönlich heftig attackiert wurde, verschwand er spurlos und noch heute weiß man nicht, ob er sich umbrachte oder vom Geheimdienst ermordet wurde, erzählt der Rezensent. Ihm hat sich sofort erschlossen, warum das schmale Buch die Gemüter damals so erregt hat, denn erzählt wird aus der Perspektive eines äußerst sensiblen Jungen aus einer lettisch-russischen Garnisonstadt, die unschwer als das heutige Daugavpils, damals Dünaburg erkennbar ist. Die ruhigen Betrachtungen des Jungen, der politische Ereignisse nur am Rande wahrnimmt und überall Beobachtungen von existentieller Bedeutung macht, entsprach so gar nicht dem "neuen Menschen" des Stalinismus und auch die Vorboten der Revolution werden in dem Roman nicht thematisiert, erklärt Spreckelsen. Es ist die "sanfte Verweigerung" eines Heranwachsenden, die aus jeder Zeile faszinierend "leicht" spricht, so der Rezensent beeindruckt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH