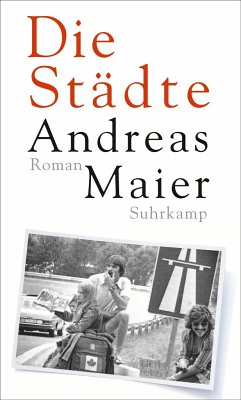In der neuen Folge seiner Ortsumgehung nimmt uns Andreas Maier mit auf Reisen. Er zeichnet das Bild der vergangenen Jahrzehnte anhand der Städte und Landschaften, die die Urlaubsrouten einer mobilitätsbesessenen Gesellschaft flankierten. Mal ist er als siebenjähriges Kind mit den Eltern im Auto unterwegs zur verhassten Ferienwohnung in Brixen, mal trampt er als Sechzehnjähriger nach Südfrankreich und hört sich Nacktbusendiskurse am Strand an. Im Piemont klappt ein Selbstmord ganz und gar nicht, und schließlich, als der Billigfliegertourismus massenhaft über uns hereinbricht, fährt er lieber nach Weimar und sieht dort zu seiner Überraschung die neuen Rechten über den Frauenplan marschieren.
»Ach, vergeblich das Fahren!«, dichtete einstmals Gottfried Benn. Die Vergeblichkeit seines und womöglich unser aller Fahrens und Reisens schildert Andreas Maier in seiner ihm eigenen raffinierten und wie immer hochkomischen Art. Dabei gelingt ihm mit zauberhafter Leichtigkeit ein Gesellschaftsporträt über drei Jahrzehnte hinweg.
»Ach, vergeblich das Fahren!«, dichtete einstmals Gottfried Benn. Die Vergeblichkeit seines und womöglich unser aller Fahrens und Reisens schildert Andreas Maier in seiner ihm eigenen raffinierten und wie immer hochkomischen Art. Dabei gelingt ihm mit zauberhafter Leichtigkeit ein Gesellschaftsporträt über drei Jahrzehnte hinweg.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Andreas Platthaus nimmt den neuen Band von Andreas Maiers Familiengeschichte als Atempause. Gewohnt lakonisch nimmt der Autor den Rezensenten mit, diesmal auf die ersten Reisen des Protagonisten in die weite Welt. Dass Platthaus der Roman als "Urlaub vom Fortschreiben" der Erzähler-Vita erscheint, liegt am Aussparen von hessischen Heimatgeschichten und daran, dass der Erzähler behauptet, der Text sei schon viel früher entstanden, vor dem ersten Band des Zyklus bereits. Resteverwertung? Schon, aber (kon-)geniale, findet Platthaus.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Kein Zufluchtsort, nirgends: Andreas Maier setzt mit "Die Städte" seinen großangelegten autobiographischen Romanzyklus fort.
Vor elf Jahren begann Andreas Maier seinen Romanzyklus mit dem unausgewiesenen Obertitel "Die Ortsumgehung". Es ist ein Projekt der eigenen Lebensschilderung, das der Autor selbst als "sein letztes Werk" bezeichnet hat, "das du so lange weiterschreibst, bis du tot bist". Elf Bände würden es werden, hieß es anfangs, und angesichts dessen, dass Maier beim Erscheinen des ersten gerade einmal dreiundvierzig war, mochte man mit einem behäbigen Publikationsrhythmus rechnen. Das Gegenteil war der Fall: Mit dem jüngsten Buch, "Die Städte", ist nun bereits der achte Teil der "Ortsumgehung" erschienen, und wenn Maier ernst machen sollte mit der Ankündigung des Schreibens daran für den Rest seines Lebens, können wir uns auf eines der ausgiebigsten autobiographischen Romanwerke der deutschsprachigen Literatur freuen. Und womöglich auf das ergiebigste.
Damit war anfangs nicht zu rechnen, so wunderbar die literarische Anlage des Projekts zwischen Sozialem und Skurrilem auch war. Die Wahrnehmung des in eine bürgerliche hessische Familie hineingeborenen Ich-Erzählers namens Andreas Maier begann mit dessen ersten bewussten Erinnerungen an die Kindheitsstadt Friedberg und weitete sich kontinuierlich biographisch-geographisch aus: vom Auftaktroman "Das Zimmer" über "Das Haus", "Die Straße", "Der Ort" bis zu "Der Kreis", ehe 2018 eine biographisch-phänomenologische Wende im Programm erfolgte, als "Die Universität" erschien, in dem zwar chronologisch noch fortgesetzt wurde, was bislang geschildert worden war, aber nunmehr neben dem Individuum auch die titelgebende Institution in den Blick kam. Das fand seine Fortsetzung 2019 in "Die Familie".
Der Schluss dieses siebten Bandes stellte einen Einschnitt im Zyklus dar, denn er griff der bisherigen Handlung weit voraus und konfrontierte den Erzähler mit einer unerwarteten Information, die seine Welt - und damit auch die des Romanprojekts selbst - erschütterte: "Meine schöne Wetterau!", rief Maiers literarisches Alter Ego aus, als es als Endvierziger erfahren musste, dass die Familienidylle mit ihrem Wohlstand auf der Arisierung jüdischen Besitzes in der NS-Zeit gründete: "Die ganze Zeit konnte sie Literatur sein. Das war ein großes Spiel. Daß das eine Form des Schweigens war, kam nicht vor." Andreas Maier, so war das zu verstehen, hatte fast ein Jahrzehnt lang erzählt, aber aus Unkenntnis nicht gesagt, was eigentlich geschehen war. Seine "Ortsumgehung" erwies sich als Geschichtsumgehung. Nicht nur der Autor selbst fragte sich in Person seines Ich-Erzählers: Wie würde es weitergehen?
"Die Städte" geben nun, zwei Jahre später, die Antwort. Maier führt darin das in "Die Universität" und "Die Familie" entwickelte Verfahren einer zeitlich übergreifenden Themensetzung fort, ja, steigert es noch, indem er das Leben abseits der hessischen Heimat, in Gestalt der eigenen Reisen, zum Thema macht. Deren Ziele, die Städte des Titels, erscheinen im Buch als Ausfluchtsorte, allerdings überwiegend unfreiwillig gewählte, denn der Erzähler verabscheut das Reisen. So begleiten wir ihn zunächst als missmutiges Kind ins familieneigene Urlaubsdomizil im Südtiroler Brixen, als Jugendlichen dann auf eine Studiosus-Reise mit Eltern und Schwester nach Athen oder auf Anhaltertour mit einem älteren Freund nach Biarritz, und weiter geht es als Student allein in den (jahreszeitlich bedingt) verlassenen italienischen Ski-Ort Oulx. Dort will der Ich-Erzähler sich umbringen (was wir schon auf Seite 9 des Romans erfahren, nie aber den Anlass dafür). Später geht es auf der Grundlage ihm lediglich von Bekannten erzählter Reisen imaginär nach Bangkok und Marrakesch (Schauplatz eines frühen literarischen Versuchs), ehe das Buch im touristenrummeligen Weimar des Jahres 2000 sein Finale findet: auf der ersten Lesereise des nunmehr tatsächlich zum Schriftsteller gewordenen Andreas Maier, der im letzten Satz beschreibt, wie er vor Publikum sein damals gerade erschienenes Romandebüt "Wäldchestag" aufschlägt: "Dann begann die Lesung."
Das ist ein Schluss des neuen Romans, der wiederum Fortsetzung signalisiert, eine Art Cliffhanger zum bevorstehenden Übergang der Handlung des Zyklus in die Maier'sche literarische Erfolgsgeschichte. Aber gerade das, diese Behauptung von Kontinuität, macht ihn nach der eigenen Bankrotterklärung aus "Die Familie" seltsam. "Die Städte" sind aber auch als Ganzes ein seltsames Buch, denn gleich zu Beginn bereits betont der Erzähler, dass es 2009 geschrieben worden sei (und später wird dieser Terminus ante quem noch einmal bekräftigt, als der 1967 geborene Erzähler sich eines Erlebnisses als Vierzehnjähriger erinnert, und "diese Begegnung ist fast drei Jahrzehnte her"). Sollen wir also vermuten, dass es sich bei den sechs Abschnitten von "Die Städte" um Texte handelt, die Maier schon vor Erscheinen des ersten Teils der "Ortsumgehung" geschrieben hat, ja, dass vielleicht dieser Zyklus schon damals weit gediehen war und das angekündigte Schreiben zum Tode nur Pose?
Dann wäre die späte Erkenntnis des Erzählers über die dubiose Familienvergangenheit tatsächlich ein Einschnitt gewesen, der das Projekt im Kern getroffen hätte, nicht nur moralisch, sondern auch materiell. Und "Die Städte" wären Resteverwertung, in die nur ein einziger Satz noch eingefügt wurde, der den neuen prekären Stand rekapituliert: Nach der Rückkehr aus Athen geht der Erzähler auf den ihm (und uns aus den früheren Büchern) vertrauten Friedhof in Friedberg. "Daß es dort keine jüdischen Grabsteine gab, fiel mir zu dieser Zeit nicht auf." Diese Passage ist nicht mehr auf dem Stande der Unschuld geschrieben. Denn im Vorläuferband hatte der Erzähler den Vorbesitzer seines Familiengrundstücks besucht: auf dem außerhalb gelegenen jüdischen Friedhof.
"Die Ortsumgehung" ist nolens volens vom literarischen Report der Bundesrepublik seit den siebziger Jahren zur Geschichtserzählung Deutschlands im ganzen zwanzigsten Jahrhundert geworden. Ihr achter Teil, "Die Städte", ist eine Atempause, Urlaub vom Fortschreiben, und insofern thematisch kongenial. Andreas Maier erweist sich einmal mehr als grandioser Lakoniker. Diesmal gegenüber seiner selbst.
ANDREAS PLATTHAUS
Andreas Maier: "Die Städte". Roman.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2021. 192 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Andreas Maier erweist sich einmal mehr als grandioser Lakoniker.« Andreas Platthaus Frankfurter Allgemeine Zeitung 20210410