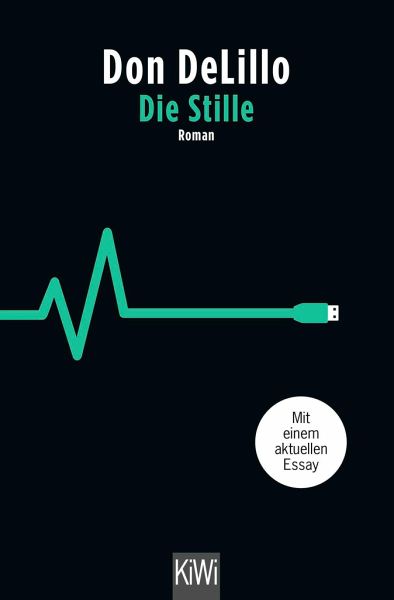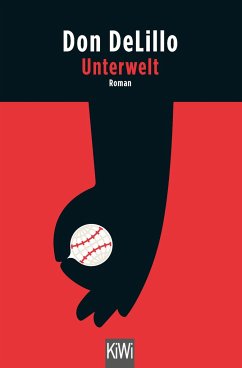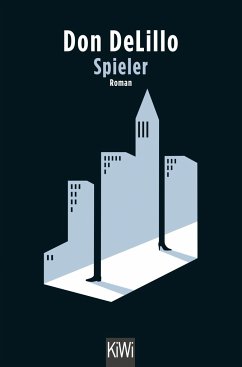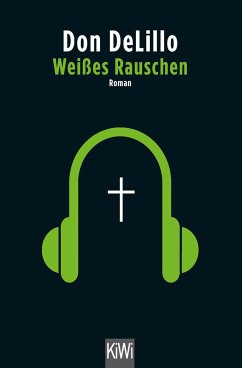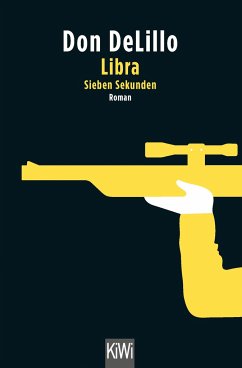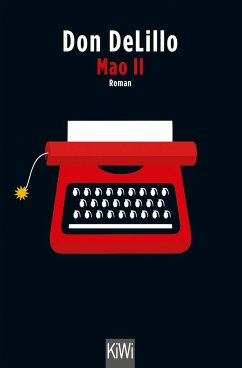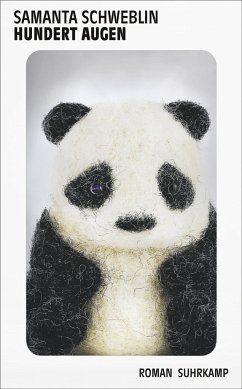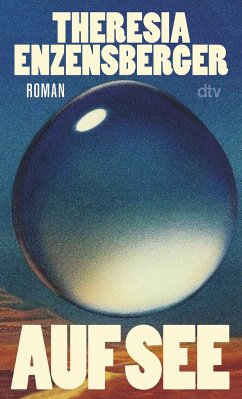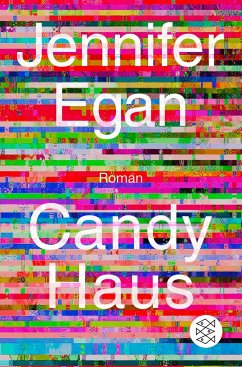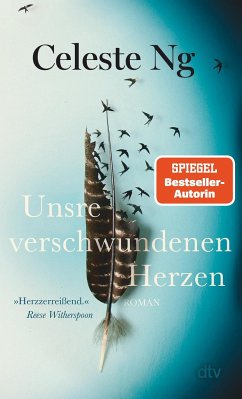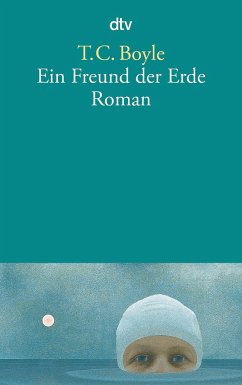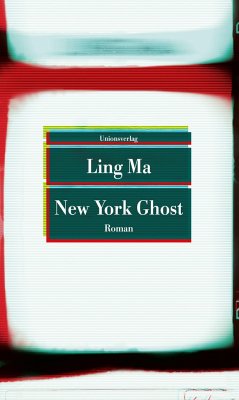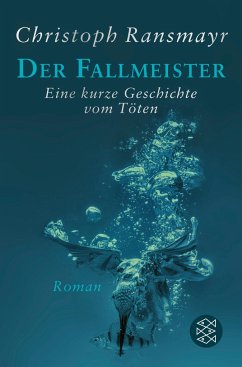Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





»Der Roman der Stunde« Stefan Maelck, MDR Kultur.»Die Stille« wurde bei Erscheinen weltweit als literarisches Meisterwerk gefeiert. In seinem internationalen Bestseller stellt DeLillo die Frage, was passiert, wenn alle digitalen Geräte versagen und die Bildschirme schwarz werden? Was machen die Menschen mit der Stille, die folgt?New York im Jahr 2022: Es ist der Super Bowl Sunday. In einer Wohnung auf der East Side von Manhattan wollen fünf Menschen gemeinsam das Finale der American Football League anschauen. Die emeritierte Physikprofessorin, ihr Mann und ihr früherer Student warten au...
»Der Roman der Stunde« Stefan Maelck, MDR Kultur.
»Die Stille« wurde bei Erscheinen weltweit als literarisches Meisterwerk gefeiert. In seinem internationalen Bestseller stellt DeLillo die Frage, was passiert, wenn alle digitalen Geräte versagen und die Bildschirme schwarz werden? Was machen die Menschen mit der Stille, die folgt?
New York im Jahr 2022: Es ist der Super Bowl Sunday. In einer Wohnung auf der East Side von Manhattan wollen fünf Menschen gemeinsam das Finale der American Football League anschauen. Die emeritierte Physikprofessorin, ihr Mann und ihr früherer Student warten auf die Ankunft eines befreundeten Paares, das gerade auf dem Rückflug von Paris ist. Auf einmal brechen alle digitalen Verbindungen ab. Die fünf versuchen sich einen Reim auf das rätselhafte, beängstigende Geschehen zu machen.
»Die Stille« wurde bei Erscheinen weltweit als literarisches Meisterwerk gefeiert. In seinem internationalen Bestseller stellt DeLillo die Frage, was passiert, wenn alle digitalen Geräte versagen und die Bildschirme schwarz werden? Was machen die Menschen mit der Stille, die folgt?
New York im Jahr 2022: Es ist der Super Bowl Sunday. In einer Wohnung auf der East Side von Manhattan wollen fünf Menschen gemeinsam das Finale der American Football League anschauen. Die emeritierte Physikprofessorin, ihr Mann und ihr früherer Student warten auf die Ankunft eines befreundeten Paares, das gerade auf dem Rückflug von Paris ist. Auf einmal brechen alle digitalen Verbindungen ab. Die fünf versuchen sich einen Reim auf das rätselhafte, beängstigende Geschehen zu machen.
Don DeLillo, 1936 geboren in New York, ist der Autor von zahlreichen Romanen und Theaterstücken. Sein umfangreiches Werk wurde mit dem National Book Award, dem PEN/Faulkner Award for Fiction, dem Jerusalem Prize und der William Dean Howells Medal from the American Academy of Arts and Letters ausgezeichnet. 2015 erhielt Don DeLillo den National Book Award Ehrenpreis für sein Lebenswerk.

Produktdetails
- Verlag: Kiepenheuer & Witsch
- Originaltitel: The Silence
- Artikelnr. des Verlages: 4004103
- 1. Auflage
- Seitenzahl: 112
- Erscheinungstermin: 9. Juni 2022
- Deutsch
- Abmessung: 187mm x 121mm x 10mm
- Gewicht: 117g
- ISBN-13: 9783462002713
- ISBN-10: 3462002716
- Artikelnr.: 62858256
Herstellerkennzeichnung
Kiepenheuer & Witsch GmbH
Bahnhofsvorplatz 1
50667 Köln
produktsicherheit@kiwi-verlag.de
Ein literarisches Frühwarnsystem
Don DeLillo erzählt in seinem neuen Roman "Die Stille" von der Nacht, in der alle Bildschirme schwarz werden, von der Pandemie und vielleicht auch vom Untergang unserer Welt
Es ist ein Sonntag im Jahr 2022, an dem alle Systeme kollabieren, es ist einer der wichtigsten Termine im amerikanischen Kalender, gleich nach dem 4. Juli, dem Nationalfeiertag. Es ist der erste Sonntag im Februar, an dem die Fernsehwerbung Spitzenpreise erzielt, weil jeder bei der Superbowl, dem Saisonfinale im American Football, zuschauen will. Das Spiel der Tennessee Titans gegen die Seattle Seahawks hat noch nicht begonnen, als alle Bildschirme schwarz werden und die komplette Stromversorgung
Don DeLillo erzählt in seinem neuen Roman "Die Stille" von der Nacht, in der alle Bildschirme schwarz werden, von der Pandemie und vielleicht auch vom Untergang unserer Welt
Es ist ein Sonntag im Jahr 2022, an dem alle Systeme kollabieren, es ist einer der wichtigsten Termine im amerikanischen Kalender, gleich nach dem 4. Juli, dem Nationalfeiertag. Es ist der erste Sonntag im Februar, an dem die Fernsehwerbung Spitzenpreise erzielt, weil jeder bei der Superbowl, dem Saisonfinale im American Football, zuschauen will. Das Spiel der Tennessee Titans gegen die Seattle Seahawks hat noch nicht begonnen, als alle Bildschirme schwarz werden und die komplette Stromversorgung
Mehr anzeigen
zusammenbricht.
Es ist dieser eine Tag, dieser eine Abend, an dem Don DeLillos neuer Roman "Die Stille" spielt. Vielleicht ist es auch gar kein Roman, das sollen die Gattungsprüfer entscheiden, mit seinen zwei Teilen und seinen insgesamt 106 Seiten. Es könnte, der Anlage, dem Setting nach, auch ein Zweiakter sein, DeLillo hat ja auch ein paar Theaterstücke geschrieben. Aber er wird schon seine Gründe gehabt haben, warum er sich für erzählende Prosa entschieden, warum er das Geschehen in die nächste Zukunft verlegt hat, warum die Handlung so konzentriert ist auf wenige Schauplätze und Personen, warum das, was die Figuren bald vom Untergang der Welt reden lässt, primär im Mikrokosmos einer New Yorker Wohnung erfahrbar wird.
Da ist ein Flugzeug, das von Paris nach Newark fliegt und kurz vorm Ziel notlanden muss, weil die elektronischen Systeme versagen: "Eine taumelnde Masse aus Metall, Glas und menschlichem Leben, vom Himmel herunter." Jim und Tessa, der Schadensregulierer bei einer Versicherung und die Dichterin, die auch Ratgeber schreibt, überleben fast unverletzt. Eine Klinik in Manhattan, in der man sie versorgt. Eine Wohnung auf der Eastside. Max, seine Frau Diane und deren ehemaliger Student Martin warten vor dem schwarzen Bildschirm noch immer auf den Kick-off und - auf Jim und Tessa, die auf einmal da sind, nach langem Fußmarsch, kurz bevor der erste Teil des Buchs endet.
Das hat eine gewisse Dramatik, apokalyptisch würde man sie aber kaum nennen. "Da passierte etwas", heißt es knapp. Im Grunde nicht viel mehr als der große Stromausfall in New York im Juli 1977, als 25 Stunden lang gar nichts mehr ging, Menschen in Fahrstühlen eingesperrt blieben, Plünderer durch die Straßen zogen. Spike Lees Film "Summer of Sam" hat die Stimmung von damals ziemlich gut eingefangen.
Dann ein plötzlicher Umschwung: die fünf Personen in der Wohnung, es ist nach Mitternacht. Aus dem Imperfekt springt die Erzählung ins Präsens. Die auktoriale Erzählerstimme klingt atemlos, wie in einer Panikattacke: "Mittlerweile ist klar, dass die Abschusscodes von unbekannten Gruppen oder Kräften per Fernsteuerung manipuliert werden. Atomwaffen sind nicht mehr einsatzfähig, weltweit ... Aber der Krieg rollt weiter, und die Begriffe häufen sich. Cyberangriff, digitale Invasion, biologische Angriffe. Anthrax. Pocken. Pathogene. Die Toten und Versehrten. Hunger, Seuche, was noch?"
Es ist dieser Ton, der auf den letzten dreißig Seiten die besonderen Schwingungen erzeugt, es ist der DeLillo-Ton, den man jetzt klar heraushört, der so unvergleichlich ist in der Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts seit "Weißes Rauschen", "Sieben Sekunden", "Unterwelt" und all den anderen Romanen. Er dringt aus dem, was die Figuren sagen, und mehr noch aus diesen Passagen, die sich keinem Sprecher zuordnen lassen, in denen ein Erzähler spricht. Diese Sequenzen haben, man kann es nicht anders sagen, manchmal auch etwas Unheimliches, weil sie von Dingen zu wissen scheinen, die anderen verborgen sind.
Tessa, die Dichterin, spricht auf einmal von dem, "was wir alle noch frisch in Erinnerung haben, das Virus, die Seuche, Corona, die Märsche durch die Flughäfen, die Masken, die entleerten Straßen der Städte". Das Wort "Corona", muss man hier ergänzen, hat DeLillo inzwischen gestrichen. Es wird in der nächsten Auflage nicht mehr auftauchen. Er wolle den direkten Bezug auf den Corona-Lockdown vermeiden.
Ohne zu wissen, wann genau DeLillo sein Manuskript abgeschlossen hat - er hat sicher nicht das zweite Gesicht, da ist kein "Shining". Eher ein phänomenales Antizipationsvermögen, eine Art literarisches Frühwarnsystem, das aus den Koordinaten einer Gegenwart Künftiges extrapoliert, ohne dass DeLillo deshalb, wie der Protagonist in Christopher Nolans Film "Tenet", ein Agent anonymer Kräfte aus der Zukunft wäre, der den Zeitpfeil umgekehrt hat. Obwohl DeLillo, der das Kino und dessen Phantasieräume liebt, diese Vorstellung womöglich gefiele, auch weil in "Die Stille" so oft von Albert Einstein die Rede ist.
Denn es ist nicht nur Tessa, die Dichterin, die über den Untergang spekuliert. Das dunkle Zentrum ist Martin, ehemaliger Schüler Dianes, die Physik unterrichtet hat, "ein Mann, der sich im zwanghaften Studium von Einsteins Manuskript zur Relativitätstheorie aus dem Jahre 1912 verloren hatte". Ganz offensichtlich stimmt mit ihm etwas nicht. Diane findet das sogar erotisch, aber Martin ist von seinen fiebrigen Visionen viel zu okkupiert, als dass es zu mehr als einem flüchtigen Annäherungsversuch käme.
Martin ist es, der Tessas verschwörungstheoretische Anflüge überbietet, die gesagt hatte: "Sind unsere Gehirne digital überarbeitet worden? Sind wir ein Experiment, das zufällig gerade auseinanderbricht?" Während sie noch Fragezeichen setzt, spricht er in Aussagesätzen, zwischendurch klingt er wie ein Einstein-Impersonator, was außer Diane aber keiner zu bemerken scheint. Wie ein düsterer Prophet behauptet er, die Zeit habe "einen Sprung nach vorne" getan, die Drohnen seien "autonom geworden", er raunt vom "Großen synoptischen Musterungsteleskop" in der chilenischen Atacamawüste und dem Ausbruch des dritten Weltkriegs.
Martin steckt sie alle an mit Weltuntergangsstimmung, mit dem GAU vom "totalen Zusammenbruch aller Systeme". Eine Stimmung, die sich widerständig gegen die Empirie zeigt, wenn Max kurz rausgeht, in die vollen Straßen, und sich fragt, ob er "einen Auszug aus Martin Dekkers Geist in 3D vor sich sieht". Sie reden weiter. Und in diesem Durcheinanderschwirren der wilden und abstrusen Gedanken schaut man zu, wie sich, gewissermaßen in der Petrischale, Verschwörungstheorien vermehren, die den Schriftsteller Don DeLillo schon immer angezogen haben, ohne dass er sich ihnen je verschrieben hätte.
"Geschichte ist die Summe all dessen, was sie uns nicht erzählen", sagt etwa im Kennedy-Buch "Sieben Sekunden" eine Figur. Aber es ist ja nie Don DeLillo, der da spricht, der am liebsten möglichst gar nicht über seine Bücher spricht - und wenn, dann redet er eben nicht wie eine Don-DeLillo-Figur. Er spielt in und mit den Figuren Weltsichten und Weltanschauungen durch, lässt sie einander hochschaukeln wie hier in "Die Stille", im Kleinen, in den vier Wänden, wo der Untergang sich leise vollzieht. Bildschirme werden schwarz, Lichter erlöschen, Kerzen brennen, die Heizung erkaltet, die Handys sind tot, im Kühlschrank ist es dunkel. Kein Big Bang, kein Atomschlag, keine Neutronenbombe, die eine menschenleere Welt zurückließe.
Wie genau diese Welt aussieht, die in den kompletten Analogzustand zurückversetzt ist, muss gar nicht beschrieben werden. Es geht um die Ahnung, was dieser Zustand in den Köpfen anrichtet. Wenn Tessa fragt: "Ist das eine Art virtuelle Realität?", kehrt DeLillos altes Motiv von der Fiktionalisierung der Welt, der schwindenden Gewissheit, was real ist, zurück, wie eine Fortschreibung der Frage aus "Unterwelt", ob der Cyberspace ein Teil der Welt sei oder die Welt ein Teil des Cyberspace.
Weit über die Seiten des Buches hinaus reicht dessen Echo in die Welt, in der wir lesen. In Zeiten der Pandemie, in denen so viel an schnellen Datenströmen hängt, am Funktionieren der digitalen Systeme in allen Bereichen des Lebens, von den Krankenhäusern bis ins Homeoffice, liest sich DeLillos Roman wie eine Vorstudie des Schlimmeren, das zentrale Strategien im Umgang mit der Pandemie hinfällig machte. Sich das Ausmaß dessen vorzustellen bleibt uns überlassen. DeLillo hat ja keine Science-Fiction geschrieben. Er erzählt im Potentialis von der Fragilität unserer Welt.
Der Roman hält die Stille nach dem Zusammenbruch fest. Die Stille, bevor wieder ein Geräusch zu hören ist. Dieser Augenblick, den DeLillos Prosa eröffnet, ist ein Innehalten auf ungewisse Zeit, bevor etwas weitergeht. Keine klassische Closure. Auch kein Signal wie das letzte Wort am Ende der fast tausend Seiten von "Unterwelt": "Frieden". Keine kleine Epiphanie wie in "Null K", wenn in Manhattan "die Sonnenstrahlen mit dem Gitternetz der Straßen zur Deckung kommen". Hier ist, zumindest in der deutschen Übersetzung, am Ende nur ein Buchstabe verschwunden, aus dem Präteritum des Verbs im letzten Satz des ersten Teils. "Dann starrt er in den schwarzen Bildschirm", so endet der Roman. Wie ein Stück, das mit einem Pausenzeichen abbricht, ohne aufzuhören, wie ein Film, der mit einem Freeze Frame endet, einem eingefrorenem Bild.
PETER KÖRTE
Don DeLillo: "Die Stille". Roman. Übersetzt von Frank Heibert. Kiepenheuer & Witsch, 112 Seiten, 20 Euro. Erscheint weltweit am Dienstag.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Es ist dieser eine Tag, dieser eine Abend, an dem Don DeLillos neuer Roman "Die Stille" spielt. Vielleicht ist es auch gar kein Roman, das sollen die Gattungsprüfer entscheiden, mit seinen zwei Teilen und seinen insgesamt 106 Seiten. Es könnte, der Anlage, dem Setting nach, auch ein Zweiakter sein, DeLillo hat ja auch ein paar Theaterstücke geschrieben. Aber er wird schon seine Gründe gehabt haben, warum er sich für erzählende Prosa entschieden, warum er das Geschehen in die nächste Zukunft verlegt hat, warum die Handlung so konzentriert ist auf wenige Schauplätze und Personen, warum das, was die Figuren bald vom Untergang der Welt reden lässt, primär im Mikrokosmos einer New Yorker Wohnung erfahrbar wird.
Da ist ein Flugzeug, das von Paris nach Newark fliegt und kurz vorm Ziel notlanden muss, weil die elektronischen Systeme versagen: "Eine taumelnde Masse aus Metall, Glas und menschlichem Leben, vom Himmel herunter." Jim und Tessa, der Schadensregulierer bei einer Versicherung und die Dichterin, die auch Ratgeber schreibt, überleben fast unverletzt. Eine Klinik in Manhattan, in der man sie versorgt. Eine Wohnung auf der Eastside. Max, seine Frau Diane und deren ehemaliger Student Martin warten vor dem schwarzen Bildschirm noch immer auf den Kick-off und - auf Jim und Tessa, die auf einmal da sind, nach langem Fußmarsch, kurz bevor der erste Teil des Buchs endet.
Das hat eine gewisse Dramatik, apokalyptisch würde man sie aber kaum nennen. "Da passierte etwas", heißt es knapp. Im Grunde nicht viel mehr als der große Stromausfall in New York im Juli 1977, als 25 Stunden lang gar nichts mehr ging, Menschen in Fahrstühlen eingesperrt blieben, Plünderer durch die Straßen zogen. Spike Lees Film "Summer of Sam" hat die Stimmung von damals ziemlich gut eingefangen.
Dann ein plötzlicher Umschwung: die fünf Personen in der Wohnung, es ist nach Mitternacht. Aus dem Imperfekt springt die Erzählung ins Präsens. Die auktoriale Erzählerstimme klingt atemlos, wie in einer Panikattacke: "Mittlerweile ist klar, dass die Abschusscodes von unbekannten Gruppen oder Kräften per Fernsteuerung manipuliert werden. Atomwaffen sind nicht mehr einsatzfähig, weltweit ... Aber der Krieg rollt weiter, und die Begriffe häufen sich. Cyberangriff, digitale Invasion, biologische Angriffe. Anthrax. Pocken. Pathogene. Die Toten und Versehrten. Hunger, Seuche, was noch?"
Es ist dieser Ton, der auf den letzten dreißig Seiten die besonderen Schwingungen erzeugt, es ist der DeLillo-Ton, den man jetzt klar heraushört, der so unvergleichlich ist in der Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts seit "Weißes Rauschen", "Sieben Sekunden", "Unterwelt" und all den anderen Romanen. Er dringt aus dem, was die Figuren sagen, und mehr noch aus diesen Passagen, die sich keinem Sprecher zuordnen lassen, in denen ein Erzähler spricht. Diese Sequenzen haben, man kann es nicht anders sagen, manchmal auch etwas Unheimliches, weil sie von Dingen zu wissen scheinen, die anderen verborgen sind.
Tessa, die Dichterin, spricht auf einmal von dem, "was wir alle noch frisch in Erinnerung haben, das Virus, die Seuche, Corona, die Märsche durch die Flughäfen, die Masken, die entleerten Straßen der Städte". Das Wort "Corona", muss man hier ergänzen, hat DeLillo inzwischen gestrichen. Es wird in der nächsten Auflage nicht mehr auftauchen. Er wolle den direkten Bezug auf den Corona-Lockdown vermeiden.
Ohne zu wissen, wann genau DeLillo sein Manuskript abgeschlossen hat - er hat sicher nicht das zweite Gesicht, da ist kein "Shining". Eher ein phänomenales Antizipationsvermögen, eine Art literarisches Frühwarnsystem, das aus den Koordinaten einer Gegenwart Künftiges extrapoliert, ohne dass DeLillo deshalb, wie der Protagonist in Christopher Nolans Film "Tenet", ein Agent anonymer Kräfte aus der Zukunft wäre, der den Zeitpfeil umgekehrt hat. Obwohl DeLillo, der das Kino und dessen Phantasieräume liebt, diese Vorstellung womöglich gefiele, auch weil in "Die Stille" so oft von Albert Einstein die Rede ist.
Denn es ist nicht nur Tessa, die Dichterin, die über den Untergang spekuliert. Das dunkle Zentrum ist Martin, ehemaliger Schüler Dianes, die Physik unterrichtet hat, "ein Mann, der sich im zwanghaften Studium von Einsteins Manuskript zur Relativitätstheorie aus dem Jahre 1912 verloren hatte". Ganz offensichtlich stimmt mit ihm etwas nicht. Diane findet das sogar erotisch, aber Martin ist von seinen fiebrigen Visionen viel zu okkupiert, als dass es zu mehr als einem flüchtigen Annäherungsversuch käme.
Martin ist es, der Tessas verschwörungstheoretische Anflüge überbietet, die gesagt hatte: "Sind unsere Gehirne digital überarbeitet worden? Sind wir ein Experiment, das zufällig gerade auseinanderbricht?" Während sie noch Fragezeichen setzt, spricht er in Aussagesätzen, zwischendurch klingt er wie ein Einstein-Impersonator, was außer Diane aber keiner zu bemerken scheint. Wie ein düsterer Prophet behauptet er, die Zeit habe "einen Sprung nach vorne" getan, die Drohnen seien "autonom geworden", er raunt vom "Großen synoptischen Musterungsteleskop" in der chilenischen Atacamawüste und dem Ausbruch des dritten Weltkriegs.
Martin steckt sie alle an mit Weltuntergangsstimmung, mit dem GAU vom "totalen Zusammenbruch aller Systeme". Eine Stimmung, die sich widerständig gegen die Empirie zeigt, wenn Max kurz rausgeht, in die vollen Straßen, und sich fragt, ob er "einen Auszug aus Martin Dekkers Geist in 3D vor sich sieht". Sie reden weiter. Und in diesem Durcheinanderschwirren der wilden und abstrusen Gedanken schaut man zu, wie sich, gewissermaßen in der Petrischale, Verschwörungstheorien vermehren, die den Schriftsteller Don DeLillo schon immer angezogen haben, ohne dass er sich ihnen je verschrieben hätte.
"Geschichte ist die Summe all dessen, was sie uns nicht erzählen", sagt etwa im Kennedy-Buch "Sieben Sekunden" eine Figur. Aber es ist ja nie Don DeLillo, der da spricht, der am liebsten möglichst gar nicht über seine Bücher spricht - und wenn, dann redet er eben nicht wie eine Don-DeLillo-Figur. Er spielt in und mit den Figuren Weltsichten und Weltanschauungen durch, lässt sie einander hochschaukeln wie hier in "Die Stille", im Kleinen, in den vier Wänden, wo der Untergang sich leise vollzieht. Bildschirme werden schwarz, Lichter erlöschen, Kerzen brennen, die Heizung erkaltet, die Handys sind tot, im Kühlschrank ist es dunkel. Kein Big Bang, kein Atomschlag, keine Neutronenbombe, die eine menschenleere Welt zurückließe.
Wie genau diese Welt aussieht, die in den kompletten Analogzustand zurückversetzt ist, muss gar nicht beschrieben werden. Es geht um die Ahnung, was dieser Zustand in den Köpfen anrichtet. Wenn Tessa fragt: "Ist das eine Art virtuelle Realität?", kehrt DeLillos altes Motiv von der Fiktionalisierung der Welt, der schwindenden Gewissheit, was real ist, zurück, wie eine Fortschreibung der Frage aus "Unterwelt", ob der Cyberspace ein Teil der Welt sei oder die Welt ein Teil des Cyberspace.
Weit über die Seiten des Buches hinaus reicht dessen Echo in die Welt, in der wir lesen. In Zeiten der Pandemie, in denen so viel an schnellen Datenströmen hängt, am Funktionieren der digitalen Systeme in allen Bereichen des Lebens, von den Krankenhäusern bis ins Homeoffice, liest sich DeLillos Roman wie eine Vorstudie des Schlimmeren, das zentrale Strategien im Umgang mit der Pandemie hinfällig machte. Sich das Ausmaß dessen vorzustellen bleibt uns überlassen. DeLillo hat ja keine Science-Fiction geschrieben. Er erzählt im Potentialis von der Fragilität unserer Welt.
Der Roman hält die Stille nach dem Zusammenbruch fest. Die Stille, bevor wieder ein Geräusch zu hören ist. Dieser Augenblick, den DeLillos Prosa eröffnet, ist ein Innehalten auf ungewisse Zeit, bevor etwas weitergeht. Keine klassische Closure. Auch kein Signal wie das letzte Wort am Ende der fast tausend Seiten von "Unterwelt": "Frieden". Keine kleine Epiphanie wie in "Null K", wenn in Manhattan "die Sonnenstrahlen mit dem Gitternetz der Straßen zur Deckung kommen". Hier ist, zumindest in der deutschen Übersetzung, am Ende nur ein Buchstabe verschwunden, aus dem Präteritum des Verbs im letzten Satz des ersten Teils. "Dann starrt er in den schwarzen Bildschirm", so endet der Roman. Wie ein Stück, das mit einem Pausenzeichen abbricht, ohne aufzuhören, wie ein Film, der mit einem Freeze Frame endet, einem eingefrorenem Bild.
PETER KÖRTE
Don DeLillo: "Die Stille". Roman. Übersetzt von Frank Heibert. Kiepenheuer & Witsch, 112 Seiten, 20 Euro. Erscheint weltweit am Dienstag.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Super Bowl Sonntag im Jahr 2022. Jim Kripps und Tessa Berens sitzen im Flieger aus Paris. Der Langstreckenflug geht an die Substanz, minutiös notiert Jim die ganzen Angaben, die auf dem Bildschirm über seinem Kopf erscheinen, auch wenn diese in Französisch sind und er nicht alles …
Mehr
Super Bowl Sonntag im Jahr 2022. Jim Kripps und Tessa Berens sitzen im Flieger aus Paris. Der Langstreckenflug geht an die Substanz, minutiös notiert Jim die ganzen Angaben, die auf dem Bildschirm über seinem Kopf erscheinen, auch wenn diese in Französisch sind und er nicht alles versteht. In New York wollen sie gemeinsam mit Freunden das Spiel des Jahres sehen. Diane Lucas und Max Stenner haben schon alles für den Fernsehabend vorbereitet, auch Martin Dekker, ein junger Physiklehrer und Dianes ehemaliger Schüler, ist schon da. Gerade als das Spiel begonnen hat, kommt es jedoch zu einem Stromausfall, der nicht nur Diane und Max‘ Wohnung, sondern ganz New York betrifft. Derweil kommt es auf dem Flughafen zu einer Notlandung, bei der ihre Gäste verletzt werden, die daher zuerst in ein Krankenhaus gebracht werden müssen.
Don DeLillo hat seinen Roman vor Ausbruch der globalen Pandemie beendet, nichtsdestotrotz finden sich durchaus einige Parallelen, vor allem in der Atmosphäre, die geprägt ist von einer gewissen Endzeitstimmung und der Tatsache, dass sich die Figuren einer unkontrollierbaren Situation ausgeliefert sehen. Auch dass es nur sehr wenig Interaktion außerhalb des kleinen Figurenzirkels gibt, spiegelt ebenfalls sehr gut die Lockdown-Situation wieder, die weltweit Millionen, wenn nicht Milliarden zur Kontaktbeschränkung auf den engsten Familien- und Freundeskreis gezwungen hat.
„Die Stille“ bricht plötzlich über die Menschen herein, wirft nicht nur alle Pläne über den Haufen, sondern stellt viele Konzepte der Figuren infrage. Versucht Jim im Flieger noch alles detailreich zu notieren, um später nochmals darauf zurückblicken zu können und sich nicht auf sein Gedächtnis verlassen zu müssen, sind seine Aufzeichnungen nach dem Crash einfach verloren. All die Mühe war umsonst und an das Ereignis selbst hat er gar keine Erinnerung. Mit einem Wimpernschlag wurde so die Gewissheit des Festhalten-Könnens zerstört.
Die Mitarbeiter im Krankenhaus haben alle Hände voll zu tun und funktionieren roboterartig. Warum Jim eine Wunde am Kopf hat, interessiert sie schon gar nicht mehr, jeder dort hat eine Geschichte zu erzählen, für die jedoch keine Zeit ist. Sie führen mechanisch die zugewiesenen Aufgaben aus und vermeiden das Philosophieren über die Gesamtlage; diese können sie ob ihrer Dimension ohnehin nicht erfassen.
In der Wohnung sieht Martin Dekker in Einsteins Theorie den ultimativen Referenzpunkt während Max noch amüsiert ist und die entstandene Leere mit Parodien der berühmt-berüchtigten Werbeclips des Super Bowl füllt. Die beiden könnten gedanklich kaum weiter auseinanderliegen, zeigen aber so die Spannbreite menschlicher Reaktionen auf eine Ausnahmesituation auf.
Endzeitszenarien haben mehrfach Eingang in DeLillos Romane gefunden, wie etwa ein Störfall in einer Chemiefabrik in „Weißes Rauschen“ oder das Leben nach der Welt, wie wir sie heute kennen, in „Zero K“. In seinem aktuellen Roman bleibt offen, was eigentlich geschehen und wie bedrohlich die Lage tatsächlich ist. Auch bietet er keine klare Deutung seines Textes an, viel Raum lässt er dem Leser selbst etwas aus dem Gelesenen zu machen. Ist es unser Verhältnis zur Technik, von der wir abhängiger sind als wir uns oft eingestehen wollen (und die wir schon lange nicht mehr verstehen – was sollen Jim all die Zahlen sagen und doch fliegt das Flugzeug)? An Martin zeigt er auch, wie die hohe Intelligenz und Bildung eher zur Verzweiflung führen, da die Gedanken in einen unkontrollierbaren Mahlstrom geraten und panisch versucht wird, das nicht Begreifbare zu erfassen. Andererseits auch das bewundernswert pragmatische Anpacke im Krankenhaus, manchmal ist es einfach die beste Lösung, das Naheliegende zu erledigen und mit Scheuklappen umherzugehen.
Don DeLillo gehört zweifelsfrei zu den besten zeitgenössischen Autoren der USA und unwillkürlich ist es ihm wieder einmal gelungen, die Stimmung der Stunde literarisch einzufangen.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Die Stille im Kopf des Lesers
Der neueste Roman des Postmodernisten Don DeLillo mit dem deskriptiven Titel «Die Stille» wird oft als Dystopie missverstanden. Diese einen einzigen Tag des Jahres 2022 schildernde Erzählung ist eine nüchterne Zustandsbeschreibung, keine …
Mehr
Die Stille im Kopf des Lesers
Der neueste Roman des Postmodernisten Don DeLillo mit dem deskriptiven Titel «Die Stille» wird oft als Dystopie missverstanden. Diese einen einzigen Tag des Jahres 2022 schildernde Erzählung ist eine nüchterne Zustandsbeschreibung, keine negative Zukunftsvision. Plakativ könnte man das so umschreiben: Nehmt doch mal allen Leuten ihre Smartphones weg und schaut, was dann passiert! Der amerikanische Autor hat den Bogen aber noch viel weiter gespannt, er nimmt einfach den Strom weg. Ein Zusammenbruch aller digitalen Systeme ist die Folge. Alle Bildschirme bleiben schwarz, früher oder später sind auch alle Akkus leer, und sämtlichen Notstrom-Aggregaten geht der Treibstoff aus.
In New York haben sich fünf Menschen verabredet, abends gemeinsam das Finale der American Football-League im Fernsehen anzuschauen. In ihrem Appartement warten die emeritierte Physik-Professorin Diane, Max, ihr footballsüchtiger Mann und Martin, einer ihrer Ex-Studenten mit Savant-Syndrom, auf ein befreundetes Paar, das rechtzeitig mit dem Flugzeug aus Paris zurückkehren will. Die farbige Tessa, eine Journalistin und Schriftstellerin, und ihr Mann Jim führen im Flugzeug eine banale, belanglose Konversation, sie starren auf die Bildschirme vor ihnen. Sowohl im Appartement als auch im Flugzeug werden die Protagonisten von außen bespaßt, sie reden nicht über sich, über ihre Erlebnisse, sie kommentieren nur die Bilder, die sie vorgespielt bekommen. Bis im Landeanflug die Displays plötzlich schwarz werden, die Maschine ins Trudeln gerät und zur Notlandung ansetzt. Leicht lädiert flüchten die Beiden aus dem havarierten Flugzeug und werden in eine Klinik gebracht, wo Jims Kopfverletzung ambulant versorgt wird. Da der Verkehr völlig zusammengebrochen ist, müssen sie zu Fuß zur Wohnung ihrer Freunde gehen. Was sollten sie auch sonst tun?
Vor dem schwarzen Bildschirm kommentiert der enttäuschte Max pantomimisch in allen Details ein fiktives sportliches Geschehen auf der Mattscheibe, einschließlich aller eingeblendeten Werbeclips. Diese makabre Reportage spiegelt eindrucksvoll die beängstigende Situation, auf die sich alle keinen Reim machen können, über die es allenfalls Mutmaßungen gibt. Betrifft der totale Crash die ganze Welt? Zusammenhanglos zitiert der inselbegabte Martin immer wieder aus Einsteins Relativitäts-Theorie, auch das Atakama Radioteleskop in Chile wird erwähnt. Es fallen Begriffe wie Krypto-Währung, Cyberangriff, Biowaffen, digitales Wettrüsten, autonome Drohnen. Gibt es womöglich bereits Menschen, denen ein Telefon implantiert wurde? «Wir werden zombifiziert», sagt Max, «wir werden verspatzenhirnt». Einprägsam ist dem schmalen Bändchen ein Zitat Albert Einsteins vorangestellt: «Ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im Vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen».
In einem kammerspielartigen Setting dreht sich das nur wenige Stunden umfassende Geschehen um nicht weniger als den Sinn der menschlichen Existenz. Jeder der fünf Protagonisten offenbart in einem theatralischen Schlussmonolog auf seine Weise seine emotionale Leere in einer saturierten Gesellschaft. Die scheint auf mediale Zerstreuungen derart angewiesen zu sein, dass sich ein totaler digitaler Crash schon fast als Nicht-Sein im philosophischen Sinne erweist. Wo nur Äußerliches wichtig erscheint, wo das Menschsein als Gesprächsstoff nicht mehr taugt, wo nur üppiger Wohlstand Befriedigung zu verschaffen vermag, da enttarnt so ein Blackout das virtuelle Paradies als Schimäre, er markiert eine Zäsur. Die allesamt konturlos bleibenden Figuren gleichen leeren Hüllen, sie reden zwar, aber sie kommunizieren nicht miteinander. Um sie herum herrscht die titelgebende Stille, die aber letztendlich auch im Kopf des Lesers keine Spuren zu hinterlassen vermag. Dazu trägt nicht wenig auch das hier ins Extreme komprimierte Erzählen bei, das sich leider allzu oft auf vage Andeutungen beschränkt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Don DeLillo, der große amerikanische Autor der Postmoderne, hat schon öfter kurze Romane geschrieben. In guter Erinnerung geblieben sind mir Der Omegapunkt und Körperzeit, auch einige Kurzgeschichten.
Die Stille ist auch sehr kurz, prägnanter als mir als Leser lieb ist. Die …
Mehr
Don DeLillo, der große amerikanische Autor der Postmoderne, hat schon öfter kurze Romane geschrieben. In guter Erinnerung geblieben sind mir Der Omegapunkt und Körperzeit, auch einige Kurzgeschichten.
Die Stille ist auch sehr kurz, prägnanter als mir als Leser lieb ist. Die Handlung ist 2022 angesiedelt.
Zugang zu den Figuren findet man nicht ganz leicht. Dabei haben viele von ihnen vielversprechende Ansätze.Interessant sind die Figuren allemal.
Da sind z.B. Max Stenner, Diane und Martin die den Superbowl ansehen wollen. Doch dann wird der Bildschirm schwarz.
Dann gibt es noch Jim und Tessa, die einen Flugzeug-beinahe-Absturz überlebt haben. Auch anderes fällt aus, z.B. Handys, Strom etc. Das nimmt im zweiten Teil immer größere Ausmaße an.
Es gibt einige Sätze, die ich ziemlich originell sind, dann gibt es aber auch ein paar, die mir einfach zu verknappt waren. Streckenweise kommt es mir wie ein zu lockeres Geplauder über den möglichen Weltuntergang vor. Als Gedankenspiel hat das auch was.
Das schmale Buch lässt mich zwiegespalten zurück. Mir hat es schon gefallen, aber das erwartete Lesefest war es doch nicht. Ein zweiter Lesegang mit etwas Abstand erscheint mir zwingend!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für