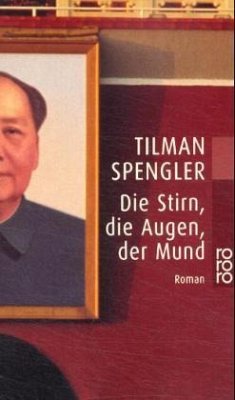Ein ironischer Politthriller über die Symbole der Macht und ihren Einfluß: In Shanghai treffen sich fünf völlig verschiedene Menschen, die alle das gleiche Ziel haben: die Beseitigung von Maos Porträt, das an der Palastmauer der Verbotenen Stadt in Peking hängt. Doch als die Verschwörer in Peking zur Tat schreiten, geht ihre Rechnung nicht auf - das Volk hängt an seinen Ikonen...

Tilman Spenglers neuer China-Roman
Achten Sie auf die Ohren, hatte der Kaiser von China gesagt. Und Tilmann Spenglers Maler von Peking hatte darauf geachtet. Hatte sich, Ohr um Ohr, Bildnis um Bildnis, vom heimlichen Heiden-Bekehrer aus Italien zum ahnungslosen Steckbrief-Fertiger fürs Reich der Mitte verkünstelt ("Der Maler von Peking", erschienen 1994). Nun lässt der studierte Sinologe vom Starnberger See noch einmal in China malen.
Doch diesmal ist alles anders. Diesmal ist der Maler von Peking kein Ausländer, pinselt keine belanglosen Visagen, hat keinen fremden Gott auf der Palette. Und achtet nicht auf die Ohren. Spenglers neuer Staatskünstler malt immer nur eins: Maos Augenbrauen. Die zwei dunklen Büschel, die Bao einmal wöchentlich abliefert, haben ihn ganz nach oben bugsiert, dorthin, wo man dreisträngige Offizierslitzen tragen, Dienstwagen fahren und zollfrei einkaufen darf. Zusammen mit den anderen, die von Maos Nasenspitze bis zu den Ohrläppchen den Rest fabrizieren und dem Roman - selbstironisches Spaßerl auf die Schöpfer-und-Werk-Ästhetik - den Titel geben: "Die Stirn, die Augen, der Mund".
Da hört der Spaß aber auch schon wieder auf. Die wackeren Verlagsleute haben nämlich überhört, dass hier jemand im Bühnenflüsterton "Vorsicht, Satire!" zischt, und verkaufen das Ganze als Politthriller (ausgerechnet wie jene noch unveröffentlichten Memoiren des Stasi-Offiziers Alexander Schalck-Golodkowski, gegen die Tilman Spengler gemeinsam mit anderen Rowohlt-Autoren Sturm läuft). Dabei lässt jeder schon nach den ersten drei Sätzen die Hoffnung auf einen Thriller fahren - und die auf eine Satire eigentlich auch.
Ein Kübelwagen stößt "schrille Warnsignale" aus, so "als handelte es sich um den Abtransport eines tödlichen Giftstoffes, vor dem die Menschen auf der Straße sich in Sicherheit bringen mussten". Deutsche Umständlichkeiten, die sich in Tatort-Tristesse auflösen wie Salz in kaltem Kaffee. "Wenn er den Hals wand, um aus dem kleinen, vergitterten Fenster zu schauen, konnte der Gefangene in den Gesichtern der Gaffer, die spärlich aufgereiht waren vor schmucklosen Fassaden, vor leeren Plätzen, vor hastig mit grauem Wellblech eingerüsteten Verkaufsständen, tatsächlich jenen unheilsgierigen Ausdruck erkennen, der in Momenten des glücklichen Entrinnens den Blick bestimmt."
Glücklich entrinnen werden nur wenige in "Die Stirn, die Augen, der Mund", und selbst die nur gerade so. Schon das ist kein kleines Kunststück nach dem abstrusen Attentat auf eine nationale Ikone, das sich der Kursbuch-Mitherausgeber Tilman Spengler aus Joseph Conrads "Secret Agent" abgekuckt hat - wo bekanntlich alle umkommen: Statt der Sternwarte in Greenwich, statt des Opernballs in Wien muss jetzt das berühmte Mao-Bild in der noch berühmteren Kaiser-Nische vor der verbotenen Stadt dran glauben: die tyrannische Technik der Repräsentation soll an sich selbst irre werden - Foucault lässt grüßen. Spenglers fünf Freunde (ohne Hund), die das Attentat wagen, bekommen alle ihre gar nicht so lustige Geschichte. Da ist die blauäugige Sinologie-Studentin Viola, die vor lauter Idealismus einen chinesischen Werftarbeiter geheiratet und ihre deutsche Staatsangehörigkeit aufgegeben hat - und die sich als einzige wundert, dass sie von ihrem Mann bespitzelt, geschlagen, betrogen wird.
Da ist ihr "Onkel Bao", der Augenbrauenmaler, der nie mehr Augenbrauen malen möchte und die Zerstörung des Mao-Bildnisses plant, weil es sein Leben und seine Kreativität zerstört hat. Da ist sein Freund, der alternde Kunsthändler Lu (sein Ahnherr machte im "Maler von Peking" Geschäfte), der es sich und seinem Geliebten Linus noch einmal zeigen will. Linus wiederum will es als amerikanischer Geheimdienstler seinen Kollegen zeigen. Und Baos Freund, der "Blitzesammler", will es allen zeigen: Explosionsartige Vernichtung als ultimativ-radikales Kunst-Werk fürs Volk - oder so ähnlich. Schlussendlich haben sie alle, wie sich's gehört, der Diktatur in die schmutzigen Hände gespielt.
So richtig mysteriös mag es nicht werden, Spenglers Lächeln à l'asiatique, das mit "Scheibenwischer"-Gelächter so wenig gemein hat wie mit Soschtschenko-Augenzwinkern. Ansteckend ist es bisweilen trotzdem. Was etwa die Fünferbande mit ihrem ergatterten Dienstsiegel alles anstellt, könnte beinahe von Kästner sein - von den Flaggen mit den fehlenden Sternen bis zu den eingeschmolzenen Mao-Broschen.
Der Amtsschimmel als Hanswurst vom Dienst zieht schließlich immer und überall, wenn die fünfzig Losungen zu Chinas Fünfzig-Jahr-Feier auch jede Satire in den Schatten stellen. Weniger witzig ist das Klischee von hässlichen Deutschen - hier ein Wirtschaftstourist -, der zur Strafe für sein schlechtes Benehmen prompt aufs Kreuz gelegt wird; so was kann ein Polt besser. Auch der Amerikaner, der - als einziger - ständig weise Worte aus den weisen Büchern der chinesischen Weisen zitiert, ist nicht gerade zum Schreien komisch.
Am besten schreibt der 1947 geborene Romancier vielleicht doch da, wo er weder einen Roman konstruiert (und dieselbe Handlung mal auf 1986, mal auf 1988 datiert) noch an seinen Karikaturen schleift; sondern dort, wo er sein China in schlichten Anekdoten erzählt. Auf einer öden Zugfahrt vertreiben sich die Leute die Zeit mit fröhlichem Beruferaten - mach mir den Klang deiner Autotür, und ich sag dir deine Privilegien. Im öden Leben vertreibt man sich die Tage mit Zotenreißen, Pornoheften - und Briefmarkensammeln.
Ein weiter Weg von Spenglers vor acht Jahren erschienenen und viel beachteten Debüt "Lenins Hirn", über den eigenen Rücken beziehungsweise sein beflügelnd lähmendes Zwicken und Zwacken ("Wenn Männer sich verheben", 1996) bis zum Samensparer Bao. Ein weiter Weg? Jedenfalls veranstaltet der Autor eine Schnitzeljagd, die an Küchenbrettern aus echter Eiche nicht vorbeigeht: Viola kriegt es auf den Schädel, und der Schriftsteller watscht damit einen Kritiker von "Der Maler von Peking" ab - der hatte ihm das Eichenbrett als Anachronismus vorgehalten.
Achten Sie auf die Ohren, hatte der Kaiser von China gesagt, und das gilt auch hier: Achten Sie auf die Ohren des Textes, nicht auf seine Schlitzohrigkeiten, nicht auf seine Stirn, seine Augen, seinen Mund. Bloß in den Ohrläppchen funkeln Spenglers Chinoiserien.
ALEXANDRA M. KEDVES.
Tilman Spengler: "Die Stirn, die Augen, der Mund". Roman. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 1999. 255 Seiten, geb., 39,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main