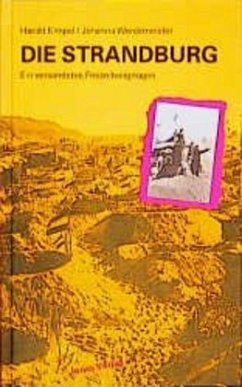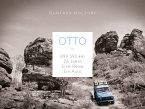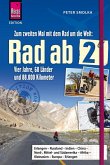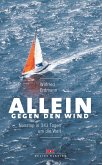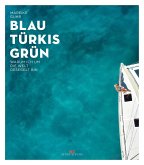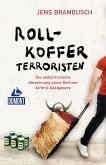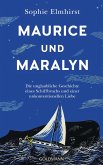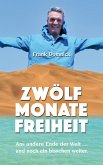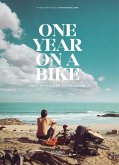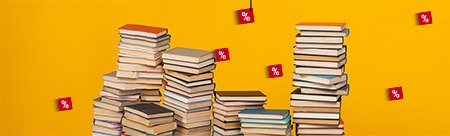Sommer, Sonne, Sand. Strandburg! Mit Saisonbeginn verwandelten sich die Badestrände an Nord- und Ostsee in Kraterlandschaften ähnlich der Mondoberfläche. "Fern der Heimat" wurde aus und auf Sand gebaut, wurde gebuddelt, gestaltet und miteinander gewetteifert. Das harmlose Treiben erweist sich bei näherer Hinsicht als Verhalten von vielfältiger Aussagekraft und erstaunlichem Symbolgehalt.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Eine Sandburg ist viel mehr als ein bröckeliger Hügel. An ihr lässt sich ablesen, wie unsere Vergangenheit im Sande verlaufen ist. Eine Kulturgeschichte
Albert Camus hätte an Sandburgen vermutlich seine Freude gehabt: stundenlanges Anhäufen, Benässen, Festklopfen, Abtragen, Modellieren und Ausschmücken von Sand in sengender Sonne, geplagt von salzigem Wind. Und niemals ein Ende in Sicht. Denn mit jedem forschen Wellenschlag und jeder hastigen Böe kommt ein Teil der Arbeit abhanden, die, ruht sie einmal, nur Stunden später gänzlich verschwunden ist. Sandburgen sind, ganz in Camus' Sinne, absurde Bauwerke.
Warum Generationen von Deutschen ihren Urlaub mit dieser Sisyphusarbeit verbracht haben, versuchten die Kulturwissenschaftler Harald Kimpel und Johanna Werckmeister zu ergründen. Monatelang gruben sie sich durch die Archive nord- und ostseeischer Urlaubsorte und sichteten Hunderte Fotos, um die Mentalität gewesener und werdender Burgherren zu begreifen. Dabei gewannen sie Einblicke in die deutsche Touristenseele, der sie "zwanghafte Verhaltensmuster" attestieren, sich die Urlaubsorte "überall auf dem Globus untertan zu machen".
Im Mittelpunkt steht dabei die Strandburg, jener trichterförmige Krater, dessen äußerer Wall den persönlichen Hoheitsbereich des Urlaubers markiert. Derart territorial gesichert, kann sich der Burgherr mit seiner Familie einrichten. Einst war die deutsche Küste übersät davon: "Früher ähnelten die Strände an Nord- und Ostsee den Kraterlandschaften des Mondes", sagt Kimpel.
Die Anfänge dieses Baustrebens liegen in den Gründerjahren, der Zeit nach der Reichseinigung 1871. Selbstbewusst gewordene Bürger strömten an die deutschen Gestade und nahmen im Sand vorweg, was später als "Platz an der Sonne" kolonialpolitisch postuliert wurde. Der Strand verwandelte sich, so der Kulturwissenschaftler Kimpel, "von der Freizeitlandschaft zur Bekenntnislandschaft". Fotos dieser Zeit zeigen Burgen dicht an dicht, einige mit patriotischen Muschelformationen geschmückt, jedes der Bauwerke ist beflaggt. Die Verteidigung gegen die Übermacht des Meeres wurde zur Metapher, zur "unbewussten Mutmaßung über das Schicksal des Reiches" - schließlich waren Strandburgen und Weltmachtanspruch gleichermaßen auf Sand gebaut, so Kimpel: Die auf Fotos heroisch posierenden Knaben in Matrosenuniform hätten später ihren aussichtslosen Kampf in Flandern fortgeführt und dabei verloren, was nicht zu retten war.
Während das Kaiserreich von Krieg und Revolution hinweggespült wurde, entstanden die Küstenbastionen immer wieder neu, gleichgültig gegenüber Wirtschaftskrisen und inneren Unruhen. Die nationalsozialistische Herrschaft war ästhetische Zäsur, schnurgerade die Linien, linientreu die Burgherren. Motivisch wurden die Strände gleichgeschaltet, überall ragte die Großmannssucht des Kleinbürgers aus dem Sand.
Nach dem Krieg entpolitisierten sich die Strände, dennoch übte der Kleinbürger die Gestaltungsmacht weiter aus. Er baute zwar weiter Strandburgen, zierte sie aber mit Slogans statt Parolen, unverdächtig und harmlos in der Motivwahl.
Im Urlaubsverhalten der DDR-Bürger konnte Kimpel kaum Hinweise auf eifrige Küstenbebauung finden: Von Mauern hatten die Ostseeurlauber offenbar genug, das alte Bedürfnis nach Abgrenzung verkehrte sich zur beliebten Freikörperkultur.
Vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik hat sich an der Architektur der Strandburgen wenig verändert, auch die Beweggründe ihrer Schöpfer blieben die gleichen. Einerseits, so Kimpel, habe der Bauherr Abstand gesucht zu seinem Nächsten, um einen eigenen Kontrollbereich zu gewinnen. Andererseits aber sei die Außenseite des Burgwalls auch eine Kommunikationsfläche. Mit deren Verzierung äußere der Burgherr "das Bedürfnis nach Ansprache von Nachbarn und Vorübergehenden".
Der Burgenbau ist zudem eine Art Beschäftigungstherapie: Kimpel spricht von Sinnstiftung und "Fortsetzung der Alltagsarbeit". Wer im Urlaub in ungewohnte Gefilde vorstoße und aus seinem Rhythmus gerate, klammere sich an Aufgaben - hoffend, sich darin selbst zu finden, sich selbst zu vergewissern. Ich baue, also bin ich.
Spuren im Sand hinterließ auch das Klischee vom fleißigen Deutschen: Müßiggang blieb selbst im Urlaub anrüchig, das Arbeitsethos duldete keine nutzlos verbrachte Zeit, kein freizeitliches Phlegma.
Auch Ehrgeiz trieb die Bauherren an: Auf schmalem Küstenstreifen sind die prestigeträchtigen Wälle ständigen Vergleichen ausgesetzt. Seit den frühen 1920er Jahren, so Kimpel, heizten die Urlaubsorte die Rivalität mit Burgenbauwettbewerben an. Wer das vorgegebene Thema in höchstmöglicher Perfektion umsetzte, den belohnte die Jury mit handgewebten Tischdecken, Schnaps und eintägigem Ruhm in Lokalzeitungen.
Die Wettbewerbe gibt es noch immer, sie heißen inzwischen "Sand Art Festivals". Die Strandburg aber ist rar geworden, vielerorts gar verboten. Aus Angst um den Küstenschutz, der durch die Krater unterminiert würde, und auch, so mutmaßt Kimpel, um die Belegungsdichte am Strand zu erhöhen: "Strandburgen stehen der Kommerzialisierung des öffentlichen Raumes entgegen."
Den Bauwerken sind allerdings auch ihre Erbauer abhandengekommen - das Bedürfnis, unmäßige Territorialforderungen zu stellen, hat abgenommen. "Ich glaube, auch die deutschen Strände haben sich globalisiert, die Mentalität des Urlaubers hat sich verändert", sagt der Kulturwissenschaftler.
Selbst die Mär vom hehren Arbeitsethos der Deutschen verpflichtet nicht mehr zur Schwerstarbeit am Strand, Nichtstun ist endlich keine Schande mehr.
Übrig ist die Sandburg, ganz ohne Wall und Mauern, zumeist auch eine Nummer kleiner als die Strandburg von einst. Frei von ideologischem Impetus hilft sie ihrem Schöpfer bei der Sinnsuche, entschleunigt und erdet, wie es daheim nur Yoga und Mandalas vermögen. Die Küsten haben ihren Burgfrieden gefunden, mit ihnen der existentialistische Sisyphus am Strand: "Man muss sich Sandburgenbauer als glückliche Menschen vorstellen", sagt Kimpel. "Glücklich, weil sie nie mit ihrer Arbeit zurande kommen."
MICHAEL SELLGER.
"Die Strandburg. Ein versandetes Freizeitvergnügen" von Harald Kimpel und Johanna Werckmeister ist 1995 im Jonas-Verlag erschienen (96 Seiten, 15 Euro).
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main