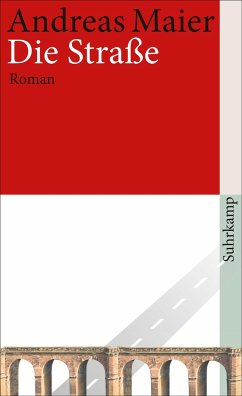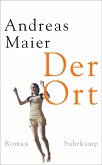Am Anfang sind es bloß Doktorspiele, aber sie sind schon von einer Dringlichkeit, die eines Erwachsenen würdig wäre. Später kommt die Bravo und gibt erstmals eine Sprache dazu. Eine jugendliche Welt aus zeitschriftengeborenen Worten wie Petting, Glied und Scheide. Der Erzähler, drei Jahre jünger als seine Schwester und ihre Freundinnen, steht staunend vor ihnen und erfährt seine erste Aufklärung ausgerechnet mit »Alice im Wunderland« ... Andreas Maier widmet sich einem ebenso interessanten wie heiklen Thema. Dem Erwachen der Sexualität in den siebziger Jahren, einer Zeit, in der dieses Thema sorgfältig in einer Parallelwelt verschlossen wird. Und Andreas Maier geht ans Eingemachte.
»Es genügt, sich zu vergegenwärtigen, welche Flut an naiven Familien- und Mehrgenerationenromanen den Buchmarkt seit einigen Jahren überschwemmt, um Andreas Maier für seine kluge Unerbittlichkeit dankbar zu sein.« Rainer Moritz Neue Zürcher Zeitung 20140109

In den frühen achtziger Jahren war sogar das beschauliche Örtchen Friedberg in der Wetterau ein Schlachtfeld frisch erwachter Jungmädchentriebe. So beschreibt es Andreas Maier, der mit "Die Straße" jetzt den dritten Teil seiner Kindheitsbeschreibungen vorlegt: naive Jungenblicke auf die Welt als einziges Sehnsuchtsgebiet.
Es klang etwas überdimensioniert, als der 1967 im hessischen Bad Nauheim geborene Schriftsteller Andreas Maier ankündigte, er wolle seine Wetterauer Kindheit in nicht weniger als elf Bände bannen, deren Titel er alle schon im Kopf hatte, als noch zu befolgende Arbeitsanleitung: "Ortsumgehung" heißt der Zyklus, nach der großen Umgehungsstraße B 3a, die Maiers alte Heimat um Friedberg zu vernichten droht und die er deshalb noch einmal besichtigen wollte. Jetzt ist, nach den Bänden "Das Zimmer" und "Das Haus", der dritte Teil erschienen, "Die Straße", die Öffnung zur Welt.
Ein Serieneffekt tritt jedenfalls schon mit diesem dritten Band ein. Man will doch wissen, wie es weitergeht, nachdem man einmal Bekanntschaft gemacht hat mit diesem "Problemandreas", einem leicht autistischen Sonderling, der als Kind erst spät zu sprechen beginnt. Den Kindergarten boykottiert er, die Schule betritt er nur ungern und mit Angst. Lieber bastelt er stundenlang allein in den dunklen Kellern des Hauses, wenn der Vater und die älteren Geschwister weg sind und nur die Mutter bei der Hausarbeit zu hören ist - die klassische Rollenverteilung der siebziger Jahre. Das Anderssein war im letzten Band das prägende Grundgefühl. Überall eckte der Junge an. Geadelt war er dafür mit einem Empfindungsreichtum, den Maier mit allen Sinnen beschwor. Aus den Augen des staunenden, abseitsstehenden Kindes betrachtet, wirkte die Welt schon da wie aus den Fugen geraten, düster und mythisch.
Jetzt sprengt Maier diese urwelthaften Dunkelräume der vorbewussten Empfindung auf. Seine Romanfigur Andreas ist mittlerweile ein Junge an der Schwelle zur Pubertät. Es zieht ihn zwar immer noch zu den kaputten Familien hin; der "heimeligen Gemütlichkeit" glücklicher Familien misstraut er. Aber er wirkt doch beruhigend weltoffen. Und so gibt es viel zu sehen aus jenen achtziger Jahren "des vorigen Jahrhunderts", einer fernen Epoche, die es zu erklären gilt. Es muss, glaubt man Maiers Zusammenschau, eine stark sexualisierte Epoche gewesen sein - nur dass niemand darüber sprach, vor allem nicht mit dem Jungen.
Plötzlich waren sie einfach da, die Krimis mit den Mordfällen, erst an jungen Frauen, dann sogar an jungen Mädchen, "es geschah offenbar einfach so". Beim Spazierengehen traf man gelegentlich auf einen Exhibitionisten. Und weil die Polizei zu wenig Schutz bot, rotteten sich besorgte Väter zusammen "wie aus einem Schillerstück" und bildeten bewaffnete Suchtrupps. Die Provinz sollte sauber und ordentlich bleiben. Wie Maier diesen kläglichen Selbstjustizapparat auftreten lässt, sagt viel aus über die Beschaffenheit der allgemeinen bundesdeutschen Kleinbürgerseele. Denn andererseits, heißt es, berührten die Väter ihre Töchter irgendwann mehr als nötig, und Mütter legten sich mit dem eigenen Sohn ins Bett, nur ein Nachthemd an, "stufenweise aufknöpfbar". "Vor draußen und der Straße wurde stets gewarnt", vor der Familie aber nicht. Und vor dem Einbruch der Wirklichkeit in den unschuldigen Pubertätskopf warnt einen ja sowieso keiner.
Maier klagt nie an, er wertet kaum. Mit erzählerischer Lust und wenig Scham kriecht er unter diese bundesdeutsche Staubdecke und beschreibt einfach nur sehr deutlich, sehr unverblümt, sehr komisch, wie für den Jungen alles permanent rätselhaft ist. Als "Geheimnisträger" benutzen ihn die drei Jahre ältere Schwester und deren Freundinnen bei ihren Doktorspielen. Der kleine Bruder muss "das Andere" zeigen, während er selbst noch unbekümmert mit der Nachbarstochter spielt, ohne "vom Anderen" überhaupt Kenntnis zu haben. Dann sind sie auch für ihn auf einmal unterscheidbar, "die zwei Geschlechter", und er skandiert erstmals munter und laut das Wort "ficken" beim Fahrradfahren, selbstvergessen und glücklich über das neu erklärte Wort. Schamhafte Leser werden bei Maiers unverblümtem Vokabular wohl an ihre Grenzen geraten.
"Coming of Age" nennt man dieses Genre gern. Und wenn Maier solche Szenen wild ausmalt, ist seine Entwicklungsgeschichte ganz in ihrem Element. Jenseits von sozialpsychologischem Vokabular erzählt er von dieser sprachlosen Phase mit theatraler Energie, und er nimmt dabei gern in Kauf, dass alles vielleicht falsch erinnert ist, aber in dieser Unfassbarkeit wahrhaftig und nah wirkt. Gerade deshalb wirkt das vertraute Gezerre um die erwachende Sexualität hier oft wie ein bizarrer Dokumentarfilm über Außerirdische und deren wundersames Treiben, lustig anzuschauen und weit weg. "Die ganze Wetterau war ja ein Sehnsuchtsgebiet. Wie die ganze Welt." Ein Riesenerotikon mit Überwachungsapparat. "Es fand alles im Zoo statt, mit meinem Vater als Zoowärter."
Ein Jahrzehnt vor dem deutschen Privatfernsehen sind die Mädchen fest in der Hand der Zeitschrift "Bravo". Die Eltern dürfen schweigen, Dr. Sommer klärt auf. Und es ist durchaus unterhaltsam, wenn Maier mit seinem nachsetzenden, zuspitzenden Stil diese beginnende mediale Auslagerung und deren Folgen beschreibt: "Vielleicht machte man später Petting nur, weil man in der Bravo davon erfahren und dann jahrelang davon geträumt hatte." Während die Mädchen ihre Tagebücher mit redundanten Textbausteinen füllen (Andreas darf sie lesen), warten sie also auf das Eintreten ihres "Bravo-Fotoromans", bevorzugt mit einem GI, Friedberg ist Kasernenstadt. Waren sie als Kinder noch ganz von dem unbestimmten "Wunsch der Einführung und deren Löchern" erfüllt, setzen sie sich jetzt mit Schlafzimmerblick in Pose.
Die Friedberger Kaiserstraße ist Flanier- und Jagdmeile, bevölkert auch von besorgten Eltern, die ihre hochexplosiven Töchter in Automobilen vorsichtig nach Hause transportieren. "So ging es jeden Tag. Zwar sah es niemand, alle taten so, als sei das nicht so, oder sie merkten es gar nicht, dabei ging es geradezu ausschließlich immer überall um das." Sogar die Altstadtmänner in den verwinkelten Gassen fallen auf: "Alle diese Friedberger, die aus ihren Altstadthäusern auf einen zutraten, sprachen auf eine sehr seltsame Weise, sie waren überaus freundlich und wollten einem meistens irgendetwas anbieten."
Es ist dieser trockene, leicht amüsierte Unterton, der alles latent Mulmige durch die naiven Jungenaugen gefiltert märchenhaft verzerrt. Andererseits weist Maier deutlich in die verriegelten Winkel der Zeit. Das Dunkle nimmt Form an mit dem amerikanischen Austauschschüler John, neben der älteren Schwester die zweite Hauptfigur im Roman. Sehnsüchtig erwartet, enttäuscht er als anhängliches Riesenbaby, das dann wundersamerweise in kürzester Zeit, von allen unbemerkt, kiffend in den klebrigen Randzonen der ordentlichen Provinz verkommt. Schon Maiers ältere Romane thematisierten die systembedingte Schuldhaftigkeit des Menschen. Dostojewski ist neben dem Evangelisten Matthäus einer von Maiers Hausheiligen. Und wenn er in seiner Poetikvorlesung ("Ich", 2006) das Triebwerk des eigenen Schreibens zwischen nietzscheanischem Nihilismus und der Vision einer Rechtfertigung vor Gott wurzeln lässt, kann man erahnen, dass der von Thomas Bernhard durchaus immer noch inspirierte Autor einen drängenden Anspruch hat. Die "zukolorierte Scham" in den schmuddeligen "Penthouse"-Magazinen, mit denen der Roman schließt, sind Teil dieser Maierschen Zivilisationsgeschichte, die auch eine Krankheitsgeschichte sein will und auch mal über die "Maschinisierungsgrade der Sehnsucht" sinniert. Maier wird, das ist zu erwarten, noch schonungsloser dem Bösen ins Gesicht springen. Wer weiß. Der vorletzte Band soll "Der Teufel" heißen, als Schlusslicht ist "Der liebe Gott" geplant.
Am überzeugendsten ist "Die Straße" als skurriles Porträt dieses Jahrzehnts: Man bestaunt den Musical-Film "Hair" und schaut nostalgisch in Perry-Rhodan-Heftchen. Man sitzt in neumodischen Glaspavillons mit Gartengrillanlagen einer Baumarkt-Kultur, die gerade erst entsteht. Und man spürt noch einmal, wie unklar einem die Welt und ihre Erscheinungen in diesem gewissen Alter sind. Genau und mitstaunend ist das geschildert. Und "auch wenn alles traurig war, so war es ja doch nicht falsch"; oft sogar irritierend heiter.
ANJA HIRSCH
Andreas Maier: "Die Straße". Roman.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2013. 194 S., geb., 17,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Angesichts naiver Familienromane auf den Büchertischen findet Rainer Moritz die Fortsetzung von Andreas Maiers Friedberg-Saga durchaus bemerkenswert. All die Niedertracht und Verdrängung und die beklemmende Finsternis einer angstgeprägten Jugend in der deutschen Provinz der 70er Jahre vermag der Autor dem Rezensenten zu vermitteln. Dass es Maier nicht gelingt, erzählerisch über die bloße Erörterung seines Themas und ein sich selbst bestätigendes Raisonnement hinauszugelangen und seinem Erzähler-Ich Handlungsraum zu verschaffen, findet Moritz dennoch bedauerlich.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH