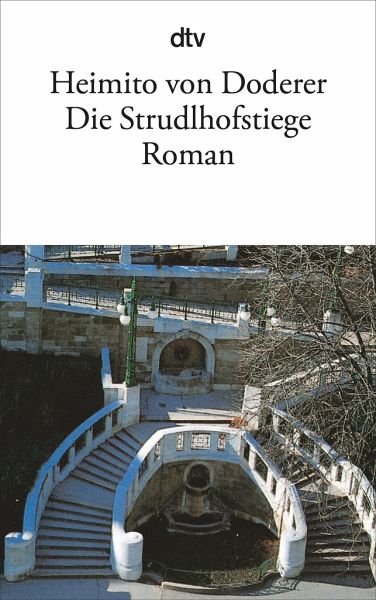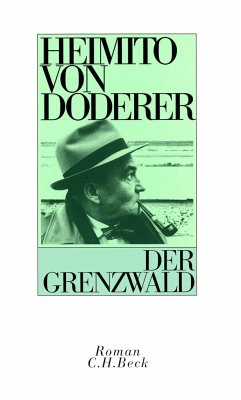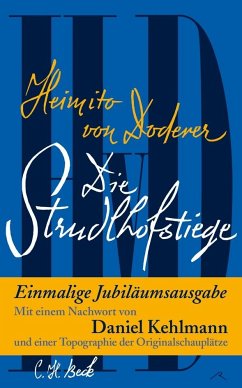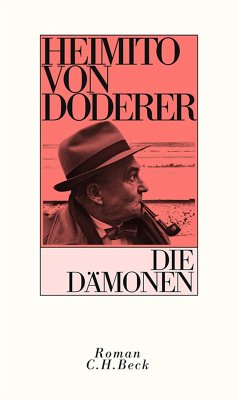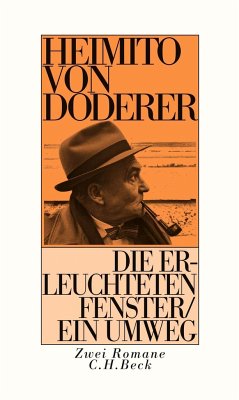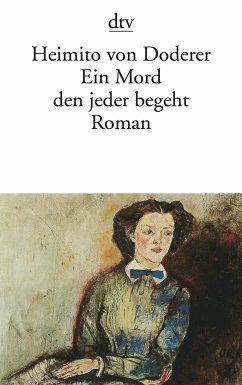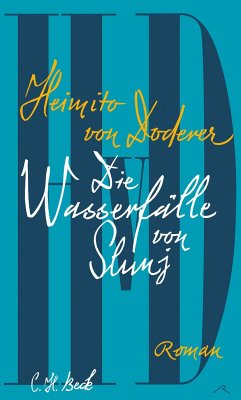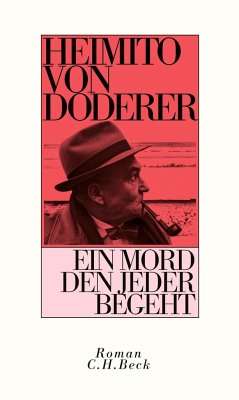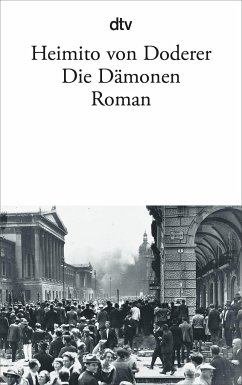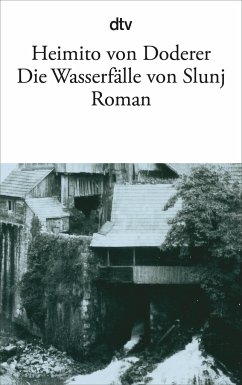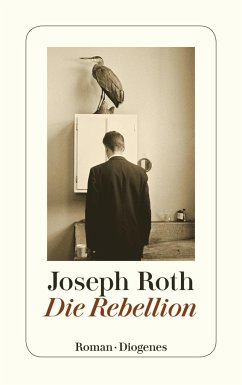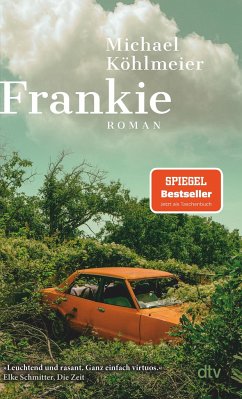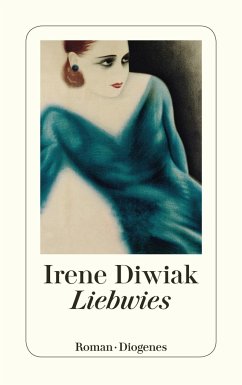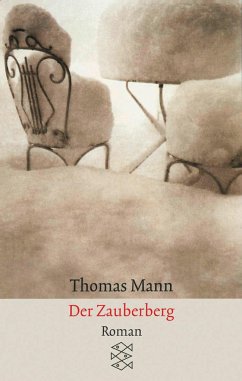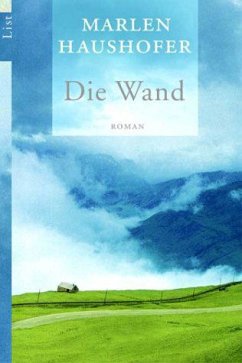Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Ein epochaler Großstadtroman
Wien in den Jahren 1910/11 und 1923-25. Im MIttelpunkt des Geschehens steht der Amtsrat und Major a. D. Melzer, dessen Leben irgendwie immer an ihm vorbeiläuft, bis er endlich doch zu sich selbst findet. Ein Großstadtroman mit der Aura des Lebens, »so, wie es ist«.
»Man müsste Heimito von Doderers Strudlhofstiege loben und preisen, bis einem die Zunge am Gaumen festklebt, bloß gebricht es an Adjektiven, die dem 1951 erschienen Roman und vor allem seiner Sprache nur annähernd angemessen wären.« Profil
Wien in den Jahren 1910/11 und 1923-25. Im MIttelpunkt des Geschehens steht der Amtsrat und Major a. D. Melzer, dessen Leben irgendwie immer an ihm vorbeiläuft, bis er endlich doch zu sich selbst findet. Ein Großstadtroman mit der Aura des Lebens, »so, wie es ist«.
»Man müsste Heimito von Doderers Strudlhofstiege loben und preisen, bis einem die Zunge am Gaumen festklebt, bloß gebricht es an Adjektiven, die dem 1951 erschienen Roman und vor allem seiner Sprache nur annähernd angemessen wären.« Profil
Als Heimito von Doderer am 5. September 1896 in Weidlingau bei Wien als Sproß einer wohlhabenden Architekten- und Ingenieursfamilie geboren wird, ist noch alles in Ordnung. Der doppelköpfige Adler hat noch viel Platz, seine Schwingen auszubreiten und der alte Kaiser Franz ist Herr über 46 Millionen Untertanen. Als der Fähnrich Ritter von Doderer 1920 jedoch aus sibirischer Gefangenschaft zurückkommt, ist die k.u.k. Herrlichkeit dahin, die Familie hat einen großen Teil ihres Vermögens eingebüßt. Entgegen den Wünschen des Vaters beschließt der Vierundzwanzigjährige Schriftsteller zu werden, nimmt jedoch in Wien ein Geschichts- und Psychologiestudium auf, das er mit der Promotion abschließt. 1938 erscheint der erste Roman: ¿Ein Mord den jeder begeht¿. Die Anerkennung als Schriftsteller bleibt ihm versagt - bis 1951, dem Erscheinungsjahr der ¿Strudlhofstiege¿. Um sich dem Mammutwerk zu nähern, empfahl Helmut Qualtinger einst folgenden Weg: den 'spannenden Krimi' ¿Ein Mord den jeder begeht¿(1938) zu Anfang, dann die ¿Kurz- und Kürzestgeschichten¿, des weiteren die ¿Dämonen¿ und schließlich die ¿Strudlhofstiege¿. In der Tat ist die Lebensgeschichte des Conrad Castiletz eine aufregende Erzählung, die in manchem auf das spätere Werk vorausweist: skurriles Personal, geschliffene Sprache, Zufälle und Unwahrscheinlichkeiten, die mit einer solchen Selbstverständlichkeit erzählt werden, daß selbst das Ungeheuerlichste plausibel erscheint. Auch wenn Doderer erst mit den nach 1951 erschienenen Büchern bekannt wurde, ist das Vorkriegswerk nicht weniger bedeutend. Unter anderem entstanden bis zum zweiten Weltkrieg die beiden Romane ¿Ein Umweg¿ (veröffentlicht 1940) und ¿Die erleuchteten Fenster oder Die Menschwerdung des Amtsrates Julius Zihal¿. Der Roman ¿Die Strudlhofstiege¿, das bedeutendste Werk Doderers, ist für den mittlerweile 55-jährigen der schriftstellerische (und somit finanzielle) Durchbruch, dem offizielle Ehrungen folgen. Die Jugendstiltreppe im IX. Bezirk ist geographischer Mittelpunkt einer Beschreibung der Wiener Gesellschaft zwischen 1910 und 1925. Der souverän gearbeitete Erzählteppich faßt die unterschiedlichsten Lebensstränge in pralle Bilder und köstliche Geschichten zusammen. Mit zum Teil denselben Figuren schrieb Doderer diese österreichische "chronique scandaleuse" in den fast 1400 Seiten umfassenden 'Dämonen' (1956) weiter. Dostojewskij frech herbeizitierend ist der in den späten zwanziger Jahren spielende Roman auch eine Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Ideologie. In beide Romane sind all die Turbulenzen eingegangen, die Doderer in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat: seine seelischen, sexuellen und politischen. Zu ihnen zählt die spannungsreiche Beziehung zu Gusti Hasterlik, der Kampf gegen den cholerischen Vater, der 'barbarische Irrtum', wie er später sagte, in der NSDAP einen gesellschaftlichen und politischen Ort finden zu können, den er 1940 mit der Konversion zum Katholizismus wettzumachen versucht. All dem wohnt der Wunsch inne, 'ein Mensch zu werden', sich von den inneren und äußeren Fesseln zu befreien, seinem literarischen Generalthema. 'Mein Leben: eine Schachtel, in die ich verpackt war, aus der ich mich herausgenommen habe.' So schrieb auch: 'Mein eigentliches Werk besteht, allen Ernstes, nicht aus Prosa oder Vers: sondern in der Erkenntnis meiner Dummheit.' Die Heirat 1952 mit Maria Thoma war Ausdruck des nächsten Schritts: sich selbst Form und Ordnung zu geben. Bei ihr im niederbayerischen Landshut lebte er jedoch nur in Abständen, um zu arbeiten, ansonsten blieb er in Wien, der Stadt, die ihm literarischer Rahmen geworden war. Grotesker Familienroman und Totalitarismuskritik in einem ist sein komischstes Werk: 'Die Merowinger' von 1962. Krönender Abschluß des Lebenswerks sollte der vierteilige 'Roman No. 7' sein. Zu Lebzeiten erschienen ist nur der erste Teil: die Vater-Sohn-Geschichte 'Die Wasserfälle von Slunj' (1963), die dem Literarischen Quartett im Doderer-Gedächtnisjahr 1996 eine Empfehlung wert war. Am 23. Dezember 1966 starb er in einem Wiener Krankenhaus an Darmkrebs, Folge seiner Alkoholexzesse - 'Der Tod steht am Rande unseres Lebens und blickt in dieses hinein. Er umrandet unsere Existenz.' (Aus dem Tagebuch vom 6. April 1964). Thomas Zirnbauer
Produktdetails
- dtv Taschenbücher 1254
- Verlag: DTV
- 28. Aufl.
- Seitenzahl: 912
- Erscheinungstermin: 1. August 1976
- Deutsch
- Abmessung: 190mm x 121mm x 30mm
- Gewicht: 478g
- ISBN-13: 9783423012546
- ISBN-10: 3423012544
- Artikelnr.: 01171490
Herstellerkennzeichnung
dtv Verlagsgesellschaft
Tumblingerstraße 21
80337 München
produktsicherheit@dtv.de
»Ein Aha-Erlebnis wie selten.« Die Presse 16.06.2007
In dem ironiegetränkten Gesellschaftsporträt entsteht ein Spiegelbild gebrochener k.u.k.-Herrlichkeit. Christian Strehk Kieler Nachrichten 20171215
»Doderers Beschreibungskunst allein kann die Lektüre zum reinen Glück machen.« DANIEL KEHLMANN, WELT AM SONNTAG »Es gibt keinen Zweifel: Wer sich eine Bibliothek mit Weltliteratur in Form von Hörbüchern aufbauen möchte, kommt an dieser Edition nicht vorbei.« WDR 3 »Hier wird fündig, wer an Hörbuchproduktionen Freude hat, die nicht schnell hingeschludert sind, sondern mit einer Regie-Idee zum Text vom und für den Rundfunk produziert sind.« NDR KULTUR »Mehr Zeit hätte man ja immer gern, aber für diese schönen Hörbücher [...] besonders.« WAZ »Die Hörbuch-Edition 'Große Werke. Große Stimmen.' umfasst herausragende Lesungen deutschsprachiger Sprecherinnen und Sprecher, die in den Archiven der Rundfunkanstalten schlummern.« SAARLÄNDISCHER RUNDFUNK
"In dieser Hörspielbearbeitung von Helmut Peschina werden Figuren wie Amtsrat Melzer und Rittmeister von Eulenfeld lebendig. Kino für die Ohren."
Auch wenn Heimito von Doderer beim modernen deutschen Lesepublikum kaum bekannt ist, kann man dieses Buch nur empfehlen. Dieses Buch ist Kult, nicht nur bei Leuten, die Verständnis dafür aufbringen, wie man wie Rene Stangeler 20 Tassen Tee trinkt. Dieses Buch ist mein absolutes …
Mehr
Auch wenn Heimito von Doderer beim modernen deutschen Lesepublikum kaum bekannt ist, kann man dieses Buch nur empfehlen. Dieses Buch ist Kult, nicht nur bei Leuten, die Verständnis dafür aufbringen, wie man wie Rene Stangeler 20 Tassen Tee trinkt. Dieses Buch ist mein absolutes Lieblingsbuch, schon allein wegen seines ersten Satzes, er verweist auf den Höhepunkt des Romans, man liest aber trotzdem mit Hochspannung die oft ellenlangen Sätze um zu erfahren, wie es dazu
kommt. Ich habe alle meine Rosensträucher nach Heldinen dieses Romans genannt.
Weniger
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Wie ein hochgeschäumter Kaiserschmarren aus weiten Sätzen mit Schlagobers.
Die Wiener werden in diesem Buch nur als Privatiers dargestellt, es geht um Bauräte und Rittmeister, Leser, Kaffeehausbesucher entlang der Strudlhofstiege, eine Treppe, die das alte Wien mit dem neuen …
Mehr
Wie ein hochgeschäumter Kaiserschmarren aus weiten Sätzen mit Schlagobers.
Die Wiener werden in diesem Buch nur als Privatiers dargestellt, es geht um Bauräte und Rittmeister, Leser, Kaffeehausbesucher entlang der Strudlhofstiege, eine Treppe, die das alte Wien mit dem neuen verbindet. Hier wird nicht gearbeitet, sondern nur getratscht, philosophiert und gedacht.
Seitenlang plätschern die Worte dahin, wie ein flirrender Bach, nur um sehr oft gehaltvolle, neue, unerahnte Sätze und Gedanken hervorzuzaubern.
Hier einige Worte die mir blieben: Verdeutlichende Leere, Sparsamkeitsnarretei, belebende Beliebtheit.
Melzer oder war es Stacheler, man kommt durcheinander bei den handelnden Personen, hat ein Buch gelesen, zu dem er immer wieder Zuflucht suchte. Dort findet sich das: „Die Aufforderung zu einer Selbstbiografie brächte die ungeheuere Mehrzahl der Menschen in die peinlichste Verlegenheit. Können doch schon die wenigsten Rede stehen, wenn man sie fragt, was sie gestern getan haben. Das Gedächtnis der Meisten ist eben bloß ein sprunghaftes.“
Man bekommt wirklich Lust, die Strudlhofstiege zu besuchen, alle Straßen drumherum, fast sehnt man sich in die Zeit zurück, in der Autotaxis und Pferdetaxis unterschieden wurden, vom langsamen Tribbtrabb hin zum puffenden Motorgeräusch, die nahende Verpestung.
Man hört einfach zu und weiß, alles ist gut, war gut, damals in Wien, als jeder Privatier war. Ab und an kommen dramatisch schöne Sätze und Gedanken, die bezaubern. Z.B. "Budapest und die ungarischen Menschen mit ihrer voll-saftigen Talentiertheit in allen Sachen des Leben und allen Ecken und Enden."
Man kann diesen Roman hören wie Musik und ab und zu in die Wort-Strudel eintauchen, ein unglaubliches Werk, im ewigen Lauf des Stiegenauf und -ab.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für