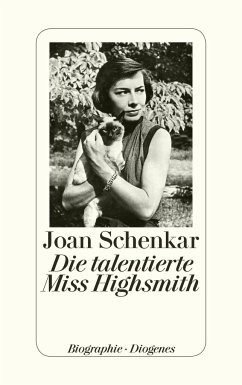Das mysteriöse Leben und die fantastische Schöpferkraft von Patricia Highsmith unterhalten noch heute ihre Leser:innen. Minuziös recherchiert und außergewöhnlich vergnüglich zu lesen, mit einem Bildteil und vielen zeitgenössischen Dokumenten im Anhang. Das Standardwerk zum Ausnahmetalent unter den Kriminalschriftstellerinnen.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Jochen Schimmang ist sich nicht ganz sicher, woran Joan Schenkar in ihrer Highsmith-Biografie letzten Endes mehr gescheitert ist: an ihrem Ehrgeiz oder an ihrer Unfähigkeit, die selbstverschuldete Materialfülle zu bewältigen. Schimmang gibt sich als großer Verehrer der Thriller-Autorin zu erkennen, und was die Biografin Schenkar über die Highsmith zusammengetragen hat, will er schon wissen: Dass die Highsmith eine echte Südtstaaten-Rassistin gewesen ist, auf dümmliche Art antisemitisch, snobistisch, hartherzig, geizig, und so weiter. Aber auf 900 Seiten? Und dann auch noch, ohne etwas Substanzielles über ihre Werke zu liefern? Das ist Schimmang die Mühe nicht wert: Denn so gut Schenkar recherchiert hat, so löblich ihr Versuch ist, motivisch und nicht chronologisch zu erzählen, so wenig hat sie dem Rezensenten am Ende mit diesem Trumm von einer Biografie die Highsmith nähergebracht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Patricia Highsmith war eine große Autorin und zugleich voller Ressentiments und Vorurteile. Wie wird man ihr in einer Biographie gerecht? Joan Schenkar versucht es mit monumentaler Detailfülle.
Patricia Highsmith war, obwohl sie seit Mitte der sechziger Jahre außerhalb Amerikas lebte, eine Rassistin nach guter alter Südstaatenart. Sie war antisemitisch, genauer gesagt: antijüdisch in besonders kruder und dümmlicher Manier. Sie war eine Alkoholikerin, die es schaffte, sich arbeitsfähig zu halten, wenn nicht der Alkohol überhaupt das Schmiermittel war, das die Arbeitsfähigkeit erst herstellte. Sie war, was vielleicht auch auf ihre familiären calvinistischen Wurzeln zurückzuführen ist, eine ausgefuchste Geschäftsfrau, die bei Verträgen um jedes halbe Prozent feilschte, und dazu extrem geizig, woran auch einzelne Anfälle von Großzügigkeit und Wohltätigkeit nichts ändern. Sie war ein Snob. Sie liebte es, ständig mehrere Affären mit Frauen zugleich zu haben, wobei sie keineswegs die Fäden immer in der Hand hatte, sondern in einzelnen Fällen durchaus abhängig, ja hörig war. Sie lebte fast ihr ganzes Leben lang in einer quälenden Konkurrenz zu ihrer Mutter, von der sie sich nicht lösen konnte, auch wenn sie durch Ozeane getrennt von ihr entfernt lebte. Sie war auf ihr Erscheinungsbild in der Rezeption ihres Werkes sehr bedacht und versuchte durchaus, darauf Einfluss zu nehmen. Sie war eine Amerikanerin, die eine typische "Expatriot" wurde, also mehr als drei Jahrzehnte ihres Lebens in Europa lebte und den Kontakt zu ihrem Geburtsland mehr und mehr verlor, was sich in ihren Büchern, soweit sie noch in Amerika spielten, bis in die Sprache hinein immer stärker niederschlug. Sie war im persönlichen Umgang nach vielerlei Zeugnissen alles andere als angenehm, auch wenn es einzelne Gegenstimmen gibt. Sie lebte zurückgezogen und abgeschottet, wovon ihr letztes Haus in Tegna im Tessin schon architektonisch ein beredtes Zeugnis ablegt, ging aber im Alter dennoch Nachbarn gern stundenlang auf die Nerven und spannte sie außerdem für Hilfsdienste aller Art ein.
Das und einiges mehr sind Befunde, die man aus Joan Schenkars monumentaler Highsmith-Biographie herausdestillieren kann, die im Jahr 2009 in Amerika erschien und nun in deutscher Übersetzung vorliegt. Das Bild vom Destillieren ist hier bewusst gewählt, denn das Problem dieser Biographie ist es, dass sie ihre Materialfülle nicht bewältigt, was den Leser zu Schwerstarbeit zwingt. Schenkar hat jahrelang überaus fleißig recherchiert, und ihr standen im Gegensatz zu früheren Biographieversuchen auch die umfangreichen privaten Tagebücher und die "Cahiers" genannten Arbeitshefte von Patricia Highsmith zur Verfügung. Sie hat eine Vielzahl von Archiven und Bibliotheken durchforstet und mit einer noch größeren Zahl von Menschen gesprochen, die Highsmith gekannt oder eine Zeitlang auf ihrem Weg begleitet haben. Schenkars Danksagung am Ende des Buches umfasst allein fünf Seiten. Mangelnde Sorgfalt kann man dieser Autorin ganz gewiss nicht vorwerfen. Sie versucht, so nah wie möglich an Patricia Highsmith, die sie fast durchängig nur "Pat" nennt, heranzukommen. So nah, dass Jonathan Lethem in seiner Besprechung des amerikanischen Originals für die "Washington Post" davon ausgegangen war, Joan Schenkar und Patricia Highsmith hätten einander persönlich gekannt, was nicht der Fall ist.
Aber Schenkar schafft es nicht, das gesichtete Material so zu organisieren, dass sie uns Patricia Highsmith näherbringt. Das liegt unter anderem daran, dass sie es sich mit dieser Biographie methodisch viel komplizierter als nötig macht. Gerade im angelsächsischen Sprachraum gibt es die gute Tradition einer rein positivistischen Biographie, die detailliert, sich bei Interpretationen aber zurückhaltend, ein Leben erzählt. Ein Paradebeispiel dafür hat vor Jahrzehnten Quentin Bell, der Neffe von Virginia Woolf, mit einer Biographie über seine Tante abgeliefert, die bis heute von ihrer Frische und Lesbarkeit nichts verloren hat. Was die Akribie bei den Fakten betrifft, kommt Schenkar ihm mühelos nah, aber ihre Ambitionen verderben ihr den richtigen Umgang mit diesen Fakten. Schon der Gedanke, der Chronologie zu folgen, ist ihr ein Greuel. Deshalb packt sie diese in Form einer ausführlichen Zeittafel in den Anhang des Buches und versucht, sich bei der eigentlichen Darstellung an durchgängigen Motiven in Highsmiths Leben zu orientieren. Methodologische Überlegungen dieser Art nehmen unter den Überschriften "Ein Wort zu Biographien", "Wie fange ich an?" und "Ein simpler Akt der Fälschung" die ersten 113 Seiten des Buches ein, die man tunlichst überschlagen sollte, um zu etwas wesentlicheren Inhalten zu kommen. Man fängt also bei "La Mamma" an und arbeitet sich dann über sechs weitere umfangreiche Kapitel, von denen mit 259 Seiten das "Les Girls" betitelte das umfangreichste ist, bis zum Schluss vor. Andere Kapitel heißen "Alter Ego" (befasst sich mit Highsmiths Arbeit in der Comicbranche, die die Autorin immer schamhaft verschwiegen hat) oder "Sozialkunde".
Das Ganze ist aber trotz dieser Versuche, nach Motiven zu ordnen, ein Etikettenschwindel, denn von dem Kapitel "La Mamma" an (warum eigentlich nicht "Die Mutter"?) erzählt Schenkar entgegen den methodologischen Skrupeln und Überlegungen im Großen und Ganzen Patricia Highsmiths Leben chronologisch - mit Vor- und Rückblenden natürlich, was in jeder biographischen Darstellung üblich und legitim ist. Es fängt dann also doch mit der Kindheit an und hört mit dem Tod auf. Dagegen ist nichts einzuwenden. Dabei arbeitet Schenkar all das, was anfangs genannt wurde, und einiges mehr heraus respektive überlässt es dem Leser, es aus der Fülle der Fakten herauszulesen. Es entsteht also dieses Bild eines nicht besonders angenehmen Menschen, der aufgrund seiner merkwürdigen Kindheit (ein fast unbekannter Vater und ein Stiefvater, dem Patricia Highsmiths ganze Abneigung galt, eine als Modezeichnerin erfolgreiche Mutter, die viel unterwegs war) voller Ressentiments und Vorurteile ist und im weiteren Leben, neben dem Ruhm und dem Reichtum, vor allem Schutz sucht. Man könnte vielleicht sogar sagen, dass der Ruhm und der Reichtum primär dazu da sind, diesen Schutz zu bieten. Vieles von diesem Bild haben wir schon gekannt, vieles Faktische war noch unbekannt, und man dankt einerseits der Autorin, dass sie es zutage gefördert hat, fragt sich andererseits aber auch, ob wirklich alle diese Fakten ausreichende Relevanz haben, um auf 879 Seiten (ohne Anhang!) ausführlich ausgebreitet zu werden.
Denn außer dass sie Alkoholikerin, Antisemitin, Rassistin und so weiter war, ist Patricia Highsmith natürlich die Autorin von etwa einem halben Dutzend Romanen, die eventuell einmal zum Kanon des zwanzigsten Jahrhunderts gehören werden. Dazu gehören das Debüt "Zwei Fremde im Zug" und der erste Ripley-Roman ebenso wie "Der Stümper", "Tiefe Wasser", "Der süße Wahn", "Der Schrei der Eule", "Die gläserne Zelle" und der fast ereignislose Roman "Das Zittern des Fälschers", bei dem der "Mord" - man müsste wohl eher von Totschlag sprechen - mit Patricia Highsmiths primärem Arbeitsmittel begangen wird, einer Schreibmaschine. Über diese Bücher erfahren wir in Schenkars Biographie, wann sie entstanden sind und veröffentlicht wurden, was den Anstoß zu ihnen gab und wie sie lebensgeschichtlich verknüpft sein könnten. Und Joan Schenkar scheut auch nicht den Versuch, diese Bücher vom Rang her einzuordnen und schwächere als solche zu bezeichnen, wie überhaupt ihre Biographie keinerlei hagiographische Tendenz hat. Aber was den eigentlichen Rang jener aus dem umfangreichen Werk herausragenden Romane ausmacht, darüber erfahren wir in jedem einzelnen der Nachworte, die Paul Ingendaay vor einem guten Jahrzehnt für die Highsmith-Werkausgabe des Diogenes-Verlags geschrieben hat, entschieden mehr als bei Joan Schenkar.
Also sei empfohlen, vor allem Highsmiths Romane selbst, die in der Rezeption bei uns ihre Hochzeit in den siebziger und achtziger Jahren gehabt haben, noch einmal zu lesen: die erste Vorstellung des schlackenrein amoralischen Tom Ripley, die großartige Studie über den sympathischen und kultivierten Victor van Allen, der gleichsam en passant dreimal zum Mörder wird, oder eben Howard Inghams langsames Einsinken in eine andere, völlig unamerikanische Welt im Norden Afrikas, in der man Einbrecher verscheucht wie Fliegen und dabei auch zu brachialen Mitteln greift. Sosehr Patricia Highsmith in ihrem eigenen Leben Schutz gesucht hat, so sehr bieten ihre Romane diesen dem Leser, der sich ihnen überlässt, und zwar gerade in den Abgründen, die sie so unerbittlich ausloten. Peter Handke hatte das schon 1975 punktgenau formuliert, als er von seinem Gefühl berichtete, hier "im Schutz einer großen Schriftstellerin zu sein". Diesem Schutz dürfen wir uns auch zwanzig Jahre nach ihrem Tod getrost überlassen.
JOCHEN SCHIMMANG
Joan Schenkar: "Die talentierte Miss Highsmith". Biographie.
Aus dem Amerikanischen von Renate Orth-Guttman, Anna-Nina Kroll und Karin Betz. Diogenes Verlag, Zürich 2015. 1069 S., Abb., geb., 29,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main