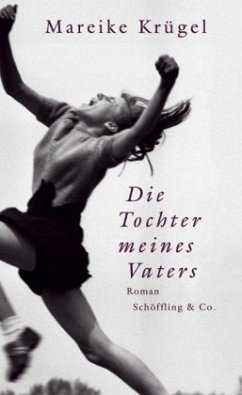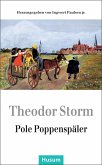Felix -eigentlich Felizia -, die Tochter des Bestatters, weiß schon in der Wiege, welches Erbe sie in Kleinulsby bei Eckernförde antreten soll. Ihre Kindheitsjahre stehen unter dem Zeichen der elterlichen Prinzipien: Höflichkeit, Diskretion und Unauffälligkeit, denen sie jedoch mit ihrem stummen Freund Gunnar auf Mauern, Bäume und Berge kletternd entflieht. Mareike Krügel erzählt geschickt auf zwei Ebenen. Sie kontrastiert die Welt des Kindes Felix mit der der erwachsenen Felizia, die aus Kleinulsby ausbricht und ihr Geld mit der Deutung des Lebens aus Tarotkarten verdient. Die großen Gefühle, die sie täglich aus den Karten liest, meidet sie, da nur Cary Grant sie aus ihrer pragmatischen Leidenschaftslosigkeit erlösen kann. Doch der heißt eigentlich Schmidt und ist von einem Traumprinz weit entfernt.Mareike Krügel legt mit Die Tochter meines Vaters sowohl einen nicht alltäglichen Entwicklungsroman vor, wie eine ergreifendkomische Familiengeschichte. Ihr trockener Sprachwitz wahrtdabei elegant die Distanz zwischen Schwarzem Humor und Empathie.

Im Kräuterbad des Lebens: Mareike Krügels zweiter Roman
Mareike Krügel hat einen Frauenroman geschrieben. Gerne würde man ein schöneres, aufregenderes Etikett für das zweite Buch der jungen Autorin finden. Aber wie soll man einen Roman bezeichnen, der von der Selbstfindung einer etwa dreißigjährigen Tarot-Beraterin handelt? Von Kräuterbädern und konturlosen Liebhabern? Vom Vater, der Bestatter in einer norddeutschen Kleinstadt war? Und vom verzweifelten Wunsch, einen Mann zu finden, der aussieht wie Cary Grant? Man kann es drehen und wenden, wie man will: Mareike Krügel hat einen Frauenroman geschrieben.
Nach ungeschriebenen Gesetzen erzählen Frauenromane von unterdrücktem Freiheitsdrang, von gebrochenen Rollenmustern und ein bißchen auch von Sex. Mit "Die Tochter meines Vaters" erfüllt die Absolventin des Deutschen Literaturinstituts in Leipzig diesen Themenkatalog leider fast mustergültig. So paßt sogar der Umschlag perfekt, der ein Mädchen in - Rollenkonflikt! - Fußballschuhen zeigt, das die Arme - Aufbegehren! - triumphierend in den Himmel reißt.
Auch im Roman selbst werden stets die naheliegendsten Symbole für das Ausbrechen aus den vorgezeichneten Lebensbahnen aufgerufen. So ist die Baumkletterei von Kindheit an das liebste Hobby der Protagonistin. Einmal hockt die Heldin in den Ästen einer Buche, als ein paar Fallschirme herabsegeln: "Ich überlegte, wie es sich wohl anfühlte, so zwischen Himmel und Erde zu schweben, nur gehalten von einem großen Stück Stoff: aufgehoben, sicher und im selben Moment wirklich frei."
Um solche violetten Sehnsüchte kreist dieser Roman, und in dieser sanften Melancholie ergeht er sich vom Anfang bis zum Ende. Tatsächlich würde man glauben, die erst 1977 geborene Schriftstellerin Mareike Krügel versuche sich in Retro-Literatur im Stil der esoterischen spätsiebziger Jahre - wenn sie in ihren zweiten Roman nicht einen Hintergrund aus generationstypischer Provinzliteratur eingezogen (schon das Debüt "Die Witwe, der Lehrer, das Meer" von 2003 spielte in und um Kiel) und ein paar allerdings kreuzbrave Gender-Motive eingebaut hätte.
Die Protagonistin heißt zwar Felizia, wird aber von ihrem Vater, der sich im tiefsten Herzen einen Sohn als Stammhalter für das Bestattungsunternehmen wünscht, nur Felix gerufen. Während die Mutter auf feminine Erziehung drängt und den Kauf von BHs erzwingt, fühlt sich Felix als echter Tomboy den Jungs in ihren verdreckten Klamotten näher als den Mädchen mit ihren langweiligen Kindergeburtstagen. Wer ihr verinnerlichtes Rollenmodell ist, macht die Ich-Erzählerin überdies durch das unentwegte Memorieren väterlicher Sentenzen klar, die allerdings den Unterhaltungswert von Kalendersprüchen besitzen: ",Dinge kosten Überwindung', pflegte mein Vater mir zu sagen. ,Aber gemacht werden müssen sie.'"
Die Kindheit in Kleinulsby bei Eckernförde ist offenbar die Folie, auf welcher Felizias erwachsenes Leben verstanden werden soll. Warum sonst montiert Krügel die prägenden Erlebnisse der kleinen Felix in erzählerischen Blöcken mitten in die Gegenwart der Dreißigjährigen hinein? So leitet sich ihr Interesse an spirituellen Wahrheitsquellen wohl vom vertrauten Kontakt mit den Toten ab, die stets im Hygieneraum gleich unter dem Elternhaus auf das Begräbnis warteten.
Auch die eigensinnige Berufsehre der Freiberuflerin hat Felizia, die ihre Kunden in der mit Räucherkerzen und Trockenkräutern ausgeschmückten Privatwohnung empfängt, klar vom Vater. Ihre Freundschaft zum bockigen Nachbarsmädchen Randi spiegelt die eigene Schulzeit, als sich die kleine Felix stets den größten Sonderling der Klasse zum Spielkameraden auserwählte. Und all ihre halbherzigen Liebschaften mit komischen Männern, die "Kohlmorgen" oder einfach "der Mann von Unten" heißen, verweisen bestimmt darauf, daß die nach Kiel geflüchtete Frau die von ihrem Lebensvorbild hinterlassene Leerstelle nicht neu besetzen will.
Doch jenseits von eher müden Quermotivationen taugen weder die in Rückblenden erzählte Biographie noch die Haupthandlung als eigenständige Erzählstränge. Felizias gegenwärtiges Projekt besteht in einer in allen Details ausgeführten "Aschenputtelaktion" - wobei es sich bei diesem mysteriösen Titel eher um eine narratologische PR-Aktion handelt, denn dahinter verbirgt sich einfach nur der Plan der Heldin, einen wegen vermeintlicher Cary-Grant-Ähnlichkeit angehimmelten Angestellten namens Schmidt durch ständige Heimsuchung zu erobern. Schmidt entpuppt sich nach uninspirierten Verfolgungsjagden durch Kiel als Transvestit, der nachts in Frauenkleidern ausgeht - und also wie das fehlende Puzzlestück zur androgynen Figur von Felix paßt. Gegen Ende sagt Schmidt dann tatsächlich diesen Satz zu Felizia: "Ab heute probierst du mal aus, wie es sich anfühlt, nur das zu tun, wozu man selber Lust hat. Gut?"
Man würde die erschreckende Erwartbarkeit der ins Romangeschehen eingepackten Botschaften gerne als bewußten Kunstgriff werten - schließlich handelt das Buch ja von Trauerberatung und Lebenshilfe, Wahrsagerei und therapeutischem Kundendienst. Doch die literarischen Mittel, mit denen diese Welt beschrieben wird, übertreffen sogar die Gegenstände an Langeweile. Keine Beschreibung geht über ein ideenloses Abschildern hinaus, an keinem Bild bleibt der Blick hängen. "Die Tochter meines Vaters" bleibt ein Roman ohne Fieberkurve, der nie wirklich aus der vorgezeichneten Bahn ausbricht. Er gleicht allenfalls jenen lauen Kräuterbädern, welche die Heldin zu Entspannungszwecken zu nehmen pflegt.
ANDREAS ROSENFELDER.
Mareike Krügel: "Die Tochter meines Vaters". Roman. Schöffling & Co. Verlag, Frankfurt am Main 2005. 316 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Andreas Rosenfelder watscht Mareike Krügels zweites Buch nach Strich und Faden ab. Seine Besprechung ist ein einziger langer Seufzer. "Man kann es drehen und wenden, wie man will": Krügel habe einen Frauenroman geschrieben, mit allem, was dazu gehört. Eine dreißigjährige Tarot-Beraterin, Tochter eines Bestatters aus der Provinz, hat sich als Mädchen wie ein Junge gefühlt und ist nun auf der Suche nach einem Mann, der wie Cary Grant aussieht. Die Autorin arbeite die Elemente des Genres "fast mustergültig" ab. Schon der Umschlag, der ein jubelndes Mädchen - "Aufbegehren!" - in Fussballschuhen - Rollenkonflikt!" - zeigt, bestätigt Rosenfelder in seinem Urteil. Und auch ansonsten gibt es keine Überraschungen. Er fühlt sich bei all den "violetten Sehnsüchten" an 70er-Jahre-Esoterik erinnert, aufgefrischt mit ein paar "allerdings kreuzbraven Gender-Motiven". Stilistisch langweilt er sich zu Tode, inhaltlich entdeckt er nichts, was als Erzählstrang taugen könnte. Und die "erschreckende Erwartbarkeit" des Romans als gewollt zu betrachten, dafür fehlt ihm nach all dem der Glaube.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Ein wunderbar schräges Buch.« Brigitte Young Miss »Mareike Krügel setzt in ihrem zweiten Roman auf eine gelungene Mischung aus Witz, Komik und solider Ernsthaftigkeit.« Frank Keil-Behrens, Titel-Magazin »Ein nicht alltäglicher Roman, der wunderbar unaffektiert und mühelos die Alltäglichkeiten beschreibt, denen man nicht begegnen möchte, die aber trotzdem unausweichlich sind.« Kreuzer »In dieser Geschichte stimmt einfach alles.« Christian Oelemann, buchkultur.de »Ein cool-humorvolles Lesebonbon.« Ellen Pomikalko, BuchMarkt »Mareike Krügel gewinnt dem ernsten Geschlechterrollenspiel entwaffnend vergnügliche Seiten ab, ohne auch nur ansatzweise in Banalität zu versanden.« Verdener-Aller-Zeitung