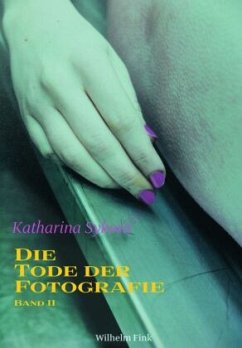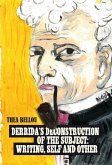Das 'Es ist gewesen' verbindet Tod und Fotografie. Fototheorien haben dieses Wirkungspotenzial von Beginn an beschrieben und hierfür einen Kanon an Metaphern ausgebildet. Für viele Fotokünstler ist der tote Körper ästhetische, mediale und ethische Herausforderung. Sie reflektieren diese Grenzerfahrung durch die Visualisierung des toten Körpers und der durch ihn provozierten Leerstellen. Die Tode der Fotografie Band II zeichnet eine Theoriegeschichte der Fotografie nach, die das Medium durchgängig mit dem Tod korreliert hat, und untersucht fotokünstlerische Positionen, die sich mit dieser Wechselwirkung auseinandersetzen. Dabei greifen die Künstlerinnen und Künstler sowohl auf theoretische Denkfiguren wie auf soziale Fotopraxen im Umgang mit den Toten zurück, wie sie in Band I von Die Tode der Fotografie untersucht wurden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Wie das Foto den Tod überflügelt, erfährt Steffen Siegel im zweiten Band von Katharina Sykoras groß angelegter Darstellung fotokünstlerischer Auseinandersetzung mit dem Tod. Roland Barthes und der Fotografie der 70er Jahre verpflichtet, gelingt der Autorin laut Siegel der Bogen über nunmehr insgesamt 1200 Seiten, indem sie Themen des ersten Bandes, wie die Kultur der Totenmaske oder Trauerriten, wiederaufnimmt. Dass der Zugriff diesmal kasuistischer ist und die Vorlieben der Autorin deutlich zutage treten, findet Siegel in Ordnung.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Katharina Sykora untersucht, wie sich die Fotografie mit dem Tod auseinandersetzt
Am Beginn der Fotografiegeschichte steht ein Selbstmord, der keiner war. Im Oktober 1840 sprang Hippolyte Bayard, tätig als Justitiar im französischen Finanzministerium, in die Seine. Er wollte auf diese triste Weise gegen ihm widerfahrenes Unrecht protestieren. Zuvor aber hatte er als Ministerialbeamter genügend Zeit gefunden, um auf eigene Faust an der Entwicklung eines Verfahrens zu tüfteln, das es ihm erlaubte, fotografische Bilder von beachtlicher Qualität zu produzieren. Es ist noch immer bemerkenswert: Ein in Physik wie Chemie kaum bewanderter Laie versuchte sich mit Erfolg an fotografischen Experimenten.
Nur konnte Bayard seinerzeit nicht damit rechnen, dass andere Erfinder schneller sein würden als er selbst. Denn während er noch experimentierte, waren in Paris wie in London die konkurrierenden fotografischen Verfahren von Daguerre und Talbot eben vorgestellt worden. Erfinderruhm und finanzielle Ausbeute gingen an Bayard vollständig vorbei.
Doch steht Bayards Selbstmord nicht am Ende seiner Fotografenkarriere, sondern vielmehr an deren Beginn. Denn was sich wie der drastische Schlusspunkt unter die Geschichte eines Misserfolgs ausnimmt, war ein gewitztes Spiel mit den Blicken des Publikums. Der Fotopionier erläuterte die Gründe für seinen inszenierten Freitod auf der Rückseite einer Aufnahme, die seinen aufgebahrten Leichnam zeigte. Er vergaß dabei nicht, die Personen und Institutionen beim Namen zu nennen, die sich seinem Erfolg in den Weg gestellt hatten. Abschließend aber signierte der Selbstmörder die Fotografie und enthüllte damit seine Aufnahme vollends als raffiniert kalkulierte Inszenierung.
So wenig zimperlich sich Bayard in der Wahl seiner Mittel zeigte, so konsequent brachte er bereits erstaunlich früh auf eine visuelle Formel, was die Fotogeschichte seither nicht mehr losgelassen hat. Ob wir von der Kamera als einer Waffe sprechen oder davon, dass etwas zu Tode fotografiert worden ist, ob wir einen spontane Aufnahme als Schnappschuss bezeichnen oder aber, wie Roland Barthes dies einmal tat, vom "Leichentuch der Pose" reden, das erst durch das Klicken der Kamera zerrissen wird - Fotografie und Tod unterhalten überraschend vielfältige Beziehungen zueinander.
Ihnen nachzugehen war das Ziel eines sechshundert Seiten starken Bandes, den die Braunschweiger Kunstwissenschaftlerin Katharina Sykora vor inzwischen sechs Jahren vorlegte (F.A.Z. vom 4. März 2010). Im Fokus dieses Buches standen die sozialen Gebrauchsweisen der Totenfotografie. Doch war bereits seinerzeit klar, dass ein zweiter Band würde folgen müssen, der ganz den fotokünstlerischen Auseinandersetzungen mit dem Tod gewidmet ist.
Dieser zweite Band ist nun erschienen und komplettiert auf fulminante Weise ein Forschungsprojekt zur Kulturgeschichte des Bildes, das überraschend häufig von uns selbst, den Lebenden handelt. Denn so viel wird umgehend deutlich: Die "Tode der Fotografie", von denen die Autorin mit schönem Doppelsinn spricht, betreffen vor allem unsere eigene Haltung gegenüber den Bildern und unser Handeln mit ihnen. Wie gehen wir um mit der irritierenden Tatsache, dass uns auf Fotografien noch immer scheinbar lebendig gegenübertritt, was schon lange aufgehört hat zu sein? Wie lässt sich die ins Bild gesetzte und vom Auge erfasste Gegenwart des Vergangenen im Bewusstsein von dessen Tod denken? Kein Zufall ist es, dass Sykora hierbei gerade den fototheoretischen Schriften von Roland Barthes eine ebenso intensive wie erhellende Lektüre widmet, war es doch Barthes, der wie kein Zweiter die Fotografie über ihr Verhältnis zum Tod zu definieren versuchte.
Trotz der langen Entstehungszeit der beiden Bücher hat die Autorin den von ihr bereits auf den ersten Seiten angelegten Bogen über nahezu tausendzweihundert Seiten konsequent fortgeführt. Hierbei verhalten sich die beiden Bände zueinander wie die zwei Tafeln eines Diptychons. Unter der Hand macht Sykora dies deutlich durch die Wiederaufnahme von Themen, denen sie bereits im ersten Band nachgegangen war. So ist auch im zweiten Band von der Kultur der Totenmaske, der Post-mortem-Fotografie und von Bild gewordenen Trauerritualen die Rede. Im Ganzen aber ist ihr Zugriff dieses Mal deutlich kasuistischer. Es liegt in der Natur der Sache: Die Vielfalt fotokünstlerischer Auseinandersetzungen mit dem Tod lässt sich kaum anders als exemplarisch diskutieren. Zwar ist das von Sykora hierbei eingerichtete Tableau systematisch gegliedert, die Vorlieben der Autorin lassen sich gleichwohl ablesen. Genauer in den Blick genommen wird vor allem die Fotokunst seit den siebziger Jahren.
Doch ist eine solche Engführung kein Zufall. Sykora selbst verweist an verschiedenen Stellen darauf, dass die fotografische Auseinandersetzung mit dem Tod seit jener Zeit immer mehr in den Rang einer "Ars moriendi" gerückt ist. Gebraucht wird die Fotografie hierbei zusehends als ein Instrument säkular gewordener Bestattungs- und Gedächtnisriten; und sie kann dies gewiss gerade deshalb sein, da das scheinbar so alltägliche Foto keinen geringen metaphysischen Überschuss anzubieten hat.
Was hierbei eine am Bild erlernte und mit dessen Hilfe geübte "Kunst des Sterbens" sein könnte, zeigt Sykora, wenn sie in einer der eindringlichsten Passagen ihres Buches auf New Yorker Fotografen wie Peter Hujar und Mark Morrisroe zu sprechen kommt, die zu den frühen Opfern der Aids-Epidemie zählen.
Den Tod der anderen und das eigene Sterben zu fotografieren hieß hier vor allem, auf dem Weg künstlerischer Produktion weiterhin Herr über das eigene Leben zu bleiben. Gerade deshalb aber haben sich auch diese jüngeren Fotografen nur scheinbar von jenem Weg entfernt, den eineinhalb Jahrhunderte zuvor der Fotopionier Bayard eingeschlagen hatte: Auf der Rückseite der Totenfotografie bleibt die Behauptung des eigenen Lebens umso schwungvoller eingetragen.
STEFFEN SIEGEL
Katharina Sykora: "Die Tode der Fotografie". Bd. II: Tod, Theorie und Fotokunst.
Wilhelm Fink Verlag, Paderborn 2015. 517 S., Abb., geb., 58,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main