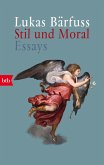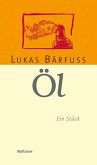Ein erfolgreicher Buchhändler beschließt, sein Leben zu ändern: Er verlässt Frau und Tochter und sagt sich von der Liebe los. Doch etwas treibt ihn zurück. Er verspürt keinen Hass, nur Ekel und vollkommene Leidenschaftslosigkeit. Alles drängt zu einer Entscheidung. Endlich glaubt er einen Weg gefunden zu haben, seine Frau hinter sich zu lassen. "Ich verblieb mir selbst, als ein unheilvoller Ort, an dem ich nicht sein und von dem ich nicht fliehen konnte", heißt es bei Augustinus über jenen überdruss, der schließlich zu einer Gefahr auch für andere wird. Mit präziser Kühle beschreibt Lukas Bärfuss in seiner fesselnden Novelle, wie der Entschluss, um der eigenen Freiheit willen seiner Liebe zu entsagen, ins Verhängnis führt.

Hilf, heiliger Florian: Lukas Bärfuss' erkaltetes Prosadebüt
Die Literatur ist reich an Männern ohne Gefühle und Eigenschaften. Angekränkelt von des Gedankens Blässe, gepeinigt von diffusem Weltekel, Angst- und Schuldgefühlen, lassen sie sich müde und willenlos treiben und ersehnen den Tod wie eine Erlösung. Der Ich-Erzähler von Lukas Bärfuss' Novelle "Die toten Männer", ein erfolgreicher Buchhändler, gehört zu den traurigsten Exemplaren dieser Gattung, denn er ist schon zu Lebzeiten sich und den Menschen abgestorben.
"Entweder Freiheit oder Liebe", sagt sich der heroische Totalverweigerer, "und ich habe mich entschieden, künftig ohne die Liebe auszukommen." Also trennt er sich von Frau und Tochter, deren lebensfrohe "Geschmeidigkeit" er als Zumutung und Fessel empfindet, und radikalisiert seine Verweigerung bis zur Selbstzerstörung: keine Beziehungen und Zärtlichkeiten mehr, keine Nahrung und kein Schlaf, keine eigene Meinung und kein Einrichtungsgegenstand, der den Stempel seiner Individualität trüge. Wenn Danielle ihn in das gemeinsame Ferienhaus im Tessin einlädt, sucht er nach trübseligen Ausflüchten, um sich nicht der Gefahr von Versöhnung und Sonnenschein aussetzen zu müssen. Wenn die Tochter an seine väterlichen Instinkte appelliert, zuckt er unangenehm berührt zurück; eher stürzt er ihren Freund in den Abgrund, als ihr das Liebesglück zu gönnen.
Das Gefängnis kann ihn nicht schrecken: "Ich würde mich nie wieder entscheiden müssen, andere würden das für mich tun . . . Lieber ein richtiges Gefängnis, eines mit Schloß und Riegel, lieber eines mit Wärtern und Blechnäpfen, als das Gefängnis der Liebe." Die Kommissarin tut ihm den Gefallen nicht und läßt die Lügen des Mörders straflos durchgehen. So ist die Schweiz: ein Kerker, grauenhaft schön tapeziert, der selbst die unbarmherzig in die Freiheit zurückstößt, die sich freiwillig dem Strafvollzug stellen wollen, ein Friedhof, der selbst erwiesenermaßen toten Männern die letzte Ruhe verleidet.
Aber ein Buchhändler weiß sich zu helfen. Warum Lesen? Bücher erzählen von unerhörten Begebenheiten und aufwühlenden Erfahrungen. In Wahrheit freilich ist das Leben "eine Abfolge der immergleichen Erlebnisse und am Ende wartet nur der Tod, und dahinter ist nichts". Aus dieser Enttäuschung kann man leicht ein Buch machen, in dem alle Badezimmer muffig riechen, alle Rosen verwelkt sind und frische Brötchen den Hungerkünstler bloß anwidern. Je enger der Himmel über der Schweiz, desto befreiter atmet der Unglückssucher auf. Wenn er an einem Begräbnis teilnehmen darf, blüht er auf und prostet den trauernden Hinterbliebenen fröhlich zu: Was für prächtige Leidensgenossen! Wenn ihn seine alte, monströs kaltherzige Mutter abkanzelt und herumschubst, keimen unter seinem Panzer Gefühle von Liebe und Dankbarkeit: Endlich nicht mehr selber entscheiden müssen!
Lukas Bärfuss hat mit Theaterstücken wie "Meienbergs Tod" oder einer grimmigen Schweiz-Kritik aus Anlaß der Expo 02 auch jenseits des Rheins auf sich aufmerksam gemacht. Sein Prosadebüt enttäuscht indes die hohen Erwartungen. Schon in Klagenfurt wurde die Novelle als "sterbenslangweilig" und sprachlich mißglückt abgefertigt, und das harsche Urteil erhärtet sich jetzt. "Die toten Männer" machen ihrem Namen tatsächlich Ehre. Sie haben mit dem Leben abgeschlossen, und wenn sie, aus Feigheit, Bequemlichkeit oder Apathie, nicht all seine Ansprüche und Wunder gebührend abweisen können, so ist das nur ein Grund mehr, mit sich zu hadern. Die Selbstabdankung jeden Eigenwillens infiziert auch die Sprache, die vom Elend der Lebensunlust erzählt. Bärfuss schreibt angemessen leidenschaftslos, und diese lakonisch erkaltete Prosa schlägt dem Leser schon bald aufs Gemüt.
Eigentlich wollte der Buchhändler einen Neuanfang wagen. Freiheit, glaubte er, sei der Bruch mit allen Erinnerungen, Bindungen und Verpflichtungen, die Verbannung von Gefühlen, Gedanken und damit vielleicht auch Schmerz. Das war ein fataler Irrtum; aber er kann nicht mehr anders, als sich "in die Ordnung der Dinge zu fügen", Mutters stählerner Lebensgier gehorsam zu willfahren und im übrigen zu hoffen, das Gewitter des Lebens werde schon vorbeiziehen, und "der schwere Hagel gehe nieder auf ein anderes Feld". Den Kopf in den Sand stecken, stoisch entsagen und zum heiligen Florian beten mag toten Männern gut zu Gesicht stehen. Aber in der Schweizer Gegenwartsliteratur, in der konstruierte Todesmetaphern ein zähes Leben führen und selbstquälerische Depressionen immer wieder die Ernte verhageln, markiert diese Haltung keinen hoffnungsvollen Neubeginn.
MARTIN HALTER
Lukas Bärfuss: "Die toten Männer". Novelle. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2002. 126 S., br., 8,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Freiheit, findet der Ich-Erzähler von Lukas Bärfuss' Erzähl-Debüt, ist mit Liebe nicht zu vereinbaren, also trennt er sich von Frau und Tochter und führt fortan ein selbstbestimmtes Leben. Diese Selbstbestimmung jedoch läuft darauf hinaus, gar nichts mehr zu wollen, keine Nahrung, keine Meinung, keinen Schlaf und über dieses Nicht-mehr-Wollen dann noch zu räsonieren. Das klingt nicht nach einem Text, dessen Lektüre Spaß macht - und der Rezensent Martin Halter ist weit davon entfernt, das Gegenteil zu behaupten. Auszüge aus der Erzählung hat Bärfuss beim Bachmann-Preis in Klagenfurt vorgestellt, sie wurden als "sterbenslangweilig" abgekanzelt. Leider zu Recht, resümiert Halter nun in Kenntnis des gesamten Textes. Kein Gewinn, bedauert er, für die Schweizer Gegenwartsliteratur.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Bärfuss zeichnet in seinem Erstling einen Mann, der geradezu manisch die Lebensäußerungen seiner Umwelt beobachtet und sorgsam auf Distanz zu bleiben trachtet. Diesem Charakterbild entspricht die unterkühlte und distanzierte Sprache, genau, klar und emotionslos. Die formale Strenge, eisern durchgehalten, bringt alles zu Stimmen: Figuren, Atmosphäre, Duktus. Ein Kabinettstück.« Sonntagszeitung 20020714