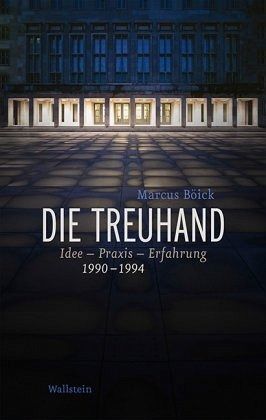
Die Treuhand
Idee - Praxis - Erfahrung 1990-1994
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
85,00 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die erste zeithistorische Untersuchung zur Treuhandanstalt, ihrem Personal und ihrem so vielschichtigen wie widersprüchlichen Arbeitsauftrag.Die Treuhandanstalt war eine der umstrittensten Organisationen in der deutschen Geschichte. Als »größtes Unternehmen der Welt« führte sie einen Vermögensumbau von bisher unbekanntem Ausmaß durch. Zwischen kollabierendem Realsozialismus und sich globalisierendem Kapitalismus überführte ihr Personal die »volkseigenen« Betriebe der DDR vom Plan zum Markt. Verkäufe an zumeist westdeutsche Investoren, Branchenabwicklungen und Massenentlassungen pr...
Die erste zeithistorische Untersuchung zur Treuhandanstalt, ihrem Personal und ihrem so vielschichtigen wie widersprüchlichen Arbeitsauftrag.Die Treuhandanstalt war eine der umstrittensten Organisationen in der deutschen Geschichte. Als »größtes Unternehmen der Welt« führte sie einen Vermögensumbau von bisher unbekanntem Ausmaß durch. Zwischen kollabierendem Realsozialismus und sich globalisierendem Kapitalismus überführte ihr Personal die »volkseigenen« Betriebe der DDR vom Plan zum Markt. Verkäufe an zumeist westdeutsche Investoren, Branchenabwicklungen und Massenentlassungen prägten ihre krisengeschüttelte Geschäftspraxis nicht weniger als wütende Proteste, politische Kontroversen und öffentliche Skandale.Jenseits zeitgenössischer Bewertungen als alternativlosem »Erfolg« oder neoliberale »Abwicklung« wirft Marcus Böick erstmals einen zeithistorischen Blick auf den widersprüchlichen Auftrag des Wirtschaftsumbaus und rückt dessen Personal in den Fokus. An der Schnittstelle von Wirtschafts- und Kulturgeschichte zeichnet der Autor mit präzisem Blick die zugrundeliegenden Ideen, den dynamischen Organisationsalltag und die facettenreichen Erfahrungen der Mitarbeiter nach, die die Transformation so maßgeblich wie unvorbereitet mitgestaltet haben.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.













