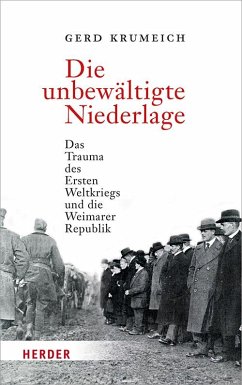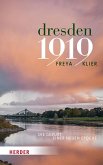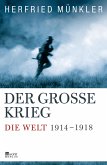Die Niederlage im Ersten Weltkrieg, die Kriegsschuldfrage und die problematischen Friedensbedingungen des Versailler Vertrages von 1919 prägten die politische Entwicklung Deutschlands in den 1920er- und 1930er-Jahren nachhaltig. Die Dolchstoßlegende wurde zu einer der wirksamsten propagandistischen Waffen gegen die Weimarer Republik. Wer die Geschichte der ersten deutschen Demokratie verstehen will, muss sich ihre Gründungssituation vergegenwärtigen. Dazu gehört auch, zu erkennen, welche Fehler beim Umgang mit dem Kriegsende gemacht wurden, auch von demokratischen Kräften. Der Historiker Gerd Krumeich erzählt entlang der Quellen und konsequent aus der Sicht der Zeitgenossen, wie das Trauma der Niederlage in eine Kultur des Hasses mündete.
Dieses Buch ist keine Geschichte der Weimarer Republik, sondern ein Versuch, einen neuen Blick auf die deutschen 1920er-Jahre zu ermöglichen. Für Gerd Krumeich ist die entscheidende Prägung der Weimarer Republik, dass sie aus dem Krieg geboren wurde und während ihrer gesamten Existenz ein Kind des Großen Krieges blieb. Die Geschichte der Weimarer Republik wurde lange Zeit von ihrem Ausgang und nicht, wie es historisch als zwingend erscheint, von ihren Ursprüngen her geschrieben. Gleichwohl ist es bislang noch nicht gelungen, sich in die Menschen von damals einzufühlen. Zwar sind die demokratischen Kräfte sehr intensiv gewürdigt worden, nicht aber ihre Gegner. Dieses Buch möchte diese Lücke ansatzweise schließen und einen neuen Blick auf die ungeheure Frustration erlauben, die der verlorene Weltkrieg für viele Millionen Deutsche bedeutet hat. Zorn und Hass waren so groß, dass schon öfter von einem "Trauma" gesprochen worden ist. Gerd Krumeich geht einen Schritt weiter in diese Richtung und versucht zu zeigen, dass es tatsächlich eine Art kollektives Trauma gegeben hat, das die Republik beherrschte. Nur wenn dieses ausgelotet wird, ist es möglich, die Katastrophe, in der die Weimarer Republik endete, historisch einzuordnen.
Mit seinem Ansatz begibt sich Gerd Krumeich auf vermintes Terrain. Vermint vor allem deshalb, weil die Probleme des "Schandfriedens" von Versailles und des "Dolchstoßes" mehreren Generationen dazu gedient hatten, die "Machtergreifung" des Nationalsozialismus zu erklären. Hitler sei erst durch "Versailles" möglich geworden, so hieß es jahrzehntelang. Aber einhundert Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges sollte es möglich sein, politisch unbefangen und frei genug hinter den traditionellen Schutzschildern hervorzutreten und "Versailles" und den "Dolchstoß" verstehend darzustellen.
War denn nun Versailles ein schmählicher oder ein zukunftsweisender Frieden? Gerd Krumeich vertritt klar die Position, dass dies kein gerechter Friede war, der angeblich viele Vorteile für Deutschland brachte. Der Friede war in Wirklichkeit ein Diktat, dessen Unterschrift wie mit vorgehaltener Pistole erzwungen wurde. Die Sieger verhandelten nicht mit dem besiegten Deutschland, und der "Kriegsschuld"-Artikel war wie der gesamte Vertrag eine moralische Herabwürdigung des geschlagenen Deutschlands.
Außerdem hebt der Historiker hervor, dass es keineswegs nur eine Dolchstoßlegende beziehungsweise Dolchstoßlüge gegeben hat. Wenn diese heute dargestellt beziehungsweise auch illustriert wird, geschieht dies in den allermeisten Fällen mit Bildern und Begriffen, wie sie die völkischen Gruppen und dann ganz besonders der Nationalsozialismus verwendet haben. Der Dolchstoßtopos besagt gemeinhin, dass die erfolgreich voranstürmenden Soldaten von auf Umsturz dringenden Zivilisten am greifbaren Sieg gehindert worden sind. Doch 1918 und 1919 hat es in der Öffentlichkeit ein sehr viel differenzierteres Bild der Niederlage gegeben.
Gerd Krumeich, einer der bekanntesten Kenner deutscher Zeitgeschichte, wirft in diesem Werk einen neuen und kontroversen Blick auf das Ende des Ersten Weltkriegs, die Novemberrevolution und die Weimarer Republik.
Dieses Buch ist keine Geschichte der Weimarer Republik, sondern ein Versuch, einen neuen Blick auf die deutschen 1920er-Jahre zu ermöglichen. Für Gerd Krumeich ist die entscheidende Prägung der Weimarer Republik, dass sie aus dem Krieg geboren wurde und während ihrer gesamten Existenz ein Kind des Großen Krieges blieb. Die Geschichte der Weimarer Republik wurde lange Zeit von ihrem Ausgang und nicht, wie es historisch als zwingend erscheint, von ihren Ursprüngen her geschrieben. Gleichwohl ist es bislang noch nicht gelungen, sich in die Menschen von damals einzufühlen. Zwar sind die demokratischen Kräfte sehr intensiv gewürdigt worden, nicht aber ihre Gegner. Dieses Buch möchte diese Lücke ansatzweise schließen und einen neuen Blick auf die ungeheure Frustration erlauben, die der verlorene Weltkrieg für viele Millionen Deutsche bedeutet hat. Zorn und Hass waren so groß, dass schon öfter von einem "Trauma" gesprochen worden ist. Gerd Krumeich geht einen Schritt weiter in diese Richtung und versucht zu zeigen, dass es tatsächlich eine Art kollektives Trauma gegeben hat, das die Republik beherrschte. Nur wenn dieses ausgelotet wird, ist es möglich, die Katastrophe, in der die Weimarer Republik endete, historisch einzuordnen.
Mit seinem Ansatz begibt sich Gerd Krumeich auf vermintes Terrain. Vermint vor allem deshalb, weil die Probleme des "Schandfriedens" von Versailles und des "Dolchstoßes" mehreren Generationen dazu gedient hatten, die "Machtergreifung" des Nationalsozialismus zu erklären. Hitler sei erst durch "Versailles" möglich geworden, so hieß es jahrzehntelang. Aber einhundert Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges sollte es möglich sein, politisch unbefangen und frei genug hinter den traditionellen Schutzschildern hervorzutreten und "Versailles" und den "Dolchstoß" verstehend darzustellen.
War denn nun Versailles ein schmählicher oder ein zukunftsweisender Frieden? Gerd Krumeich vertritt klar die Position, dass dies kein gerechter Friede war, der angeblich viele Vorteile für Deutschland brachte. Der Friede war in Wirklichkeit ein Diktat, dessen Unterschrift wie mit vorgehaltener Pistole erzwungen wurde. Die Sieger verhandelten nicht mit dem besiegten Deutschland, und der "Kriegsschuld"-Artikel war wie der gesamte Vertrag eine moralische Herabwürdigung des geschlagenen Deutschlands.
Außerdem hebt der Historiker hervor, dass es keineswegs nur eine Dolchstoßlegende beziehungsweise Dolchstoßlüge gegeben hat. Wenn diese heute dargestellt beziehungsweise auch illustriert wird, geschieht dies in den allermeisten Fällen mit Bildern und Begriffen, wie sie die völkischen Gruppen und dann ganz besonders der Nationalsozialismus verwendet haben. Der Dolchstoßtopos besagt gemeinhin, dass die erfolgreich voranstürmenden Soldaten von auf Umsturz dringenden Zivilisten am greifbaren Sieg gehindert worden sind. Doch 1918 und 1919 hat es in der Öffentlichkeit ein sehr viel differenzierteres Bild der Niederlage gegeben.
Gerd Krumeich, einer der bekanntesten Kenner deutscher Zeitgeschichte, wirft in diesem Werk einen neuen und kontroversen Blick auf das Ende des Ersten Weltkriegs, die Novemberrevolution und die Weimarer Republik.

Vom Anfang und Ende der ersten deutschen Demokratie: Gerd Krumeich bilanziert die Lasten des verlorenen Kriegs für die Weimarer Republik.
Von Wolfram Pyta
Die deutsche Geschichtswissenschaft hat die Folgen des 1919 unterzeichneten Versailler Vertrags für die Stabilität der ersten deutschen Demokratie bislang eher am Rande behandelt. War dieser von der deutschen Seite als hart und unehrenhaft empfundene Frieden vermeidbar? Hätte das Deutsche Reich bessere Friedensbedingungen erreichen können, wenn es bis ins Frühjahr 1919 weitergekämpft hätte? Solche Fragen hatten bereits die Zeitgenossen seit Kriegsende umgetrieben; und in der Weimarer Republik hat sie vor allem der extreme Nationalismus als wohlfeile Munition gegen die Weimarer Republik instrumentalisiert. Gerd Krumeich, Doyen der deutschen Frankreich-Historiker und international renommierten Experten speziell zum Ersten Weltkrieg, hat sich ihrer nun in seinem Buch angenommen.
Der erste Teil seiner Studie widmet sich der Kardinalfrage, ob Deutschland erträglichere Friedensbedingungen hätte herausschlagen können, wenn es nicht im November 1918 einen Waffenstillstand eingegangen wäre, den Krumeich mit Recht als kaum verschleierte Kapitulation ansieht. Dabei lässt er nicht den geringsten Zweifel daran, dass der Weltkrieg für das Reich verloren war. Es geht ihm allein um die Frage, ob die Westfront im Herbst 1918 noch so gefestigt gewesen sei, dass Deutschland mit längerem Atem aus einer solchen Position heraus günstigere Waffenstillstands- und Friedensbedingungen hätte erwirken können, zumal auch die alliierten Gegner mit einer Fortsetzung des Kriegs bis in das Jahr 1919 rechneten.
Krumeich beantwortet diese Frage mit einem ziemlich klaren Ja: Die Kampfmoral der Westfront sei weitgehend intakt gewesen; alle Rückzüge seien geordnet auf ausgebaute Stellungen verlaufen. Damit aber stellt sich eine Frage erneut mit ganzer Wucht, welche schon die Zeitgenossen beschäftigte: Warum hat sich die Oberste Heeresleitung (OHL), das militärische Entscheidungszentrum, veranlasst gesehen, Anfang Oktober 1918 die politische Führung geradezu ultimativ um die Einleitung von Waffenstillstandsverhandlungen zu ersuchen? Denn nach obiger Lesart hätte kein Grund zu einer solch überstürzten Aktion bestanden.
Krumeich löst diese argumentative Schwierigkeit dadurch, dass er Ludendorff als der treibenden Kraft dahinter den Willen eben nicht zu einem Waffenstillstand, sondern nur zu einer Waffenruhe zuschreibt: Der starke Mann der OHL habe so Kraft sammeln wollen, um das erschöpfte Westheer zu sammeln und dann aus einer Position relativer Stärke heraus Friedensverhandlungen einzuleiten. Allerdings sprechen die Quellen eher gegen diese Annahme: Ludendorff drang energisch auf ein Ende der Kampfhandlungen - und zwar deswegen, weil er sich der Zuverlässigkeit des Westheeres nicht mehr sicher war, seine Zersetzung durch linksradikale Parolen befürchtete und durch eine rasche Einstellung der Kampfhandlungen dem Deutschen Reich wenigstens das politische Instrument eines noch intakten und dem Befehl seiner Führer folgenden Frontheeres erhalten wollte.
Im Hintergrund taucht die grundlegende Frage auf, wie stark denn das Westheer unter dem Einfluss der durch den Sieg der Bolschewisten in Sowjetrussland beflügelten revolutionären Ideen stand. Man muss sich dabei immer wieder vor Augen halten, dass die Novemberrevolution nicht das Werk eines revoltierenden Industrieproletariats war, sondern durch aufständische Matrosen und Soldaten der Heimatgarnisonen ausgelöst wurde. Hier gelangt Krumeich zu einer nüchternen Einschätzung, welche die Selbstüberschätzung der Linksradikalen, die sich die Urheberrechte an der Revolution sichern wollten, nicht für bare Münze nimmt, aber auch keinen Hehl daraus macht, dass die Parole einer raschen Kriegsbeendigung gerade unter dem aus der Industrie reklamierten Soldatennachwuchs auf fruchtbaren Boden fiel.
Krumeich hegt großen Respekt vor der Lauterkeit der Friedensaktivisten und auch jener Revolutionäre der ersten Stunde wie Kurt Eisner, die vor der Weltöffentlichkeit Dokumente präsentierten, welche das soeben überwundene System der Kriegstreiberei überführten. Er meldet jedoch erhebliche Zweifel an der politischen Klugheit einer solchen Selbstbezichtigung an. Denn die Siegermächte nutzten das Material, um ohne Rücksichtnahme auf die junge deutsche Demokratie dem geschlagenen Deutschland überaus harte Friedensbedingungen aufzuerlegen.
Welche Hypothek bürdete der verlorene Krieg der ersten deutschen Demokratie auf? Diese Kardinalfrage geht Krumeich auf eine methodisch innovative Weise an, indem er das Konzept "kollektives Trauma" einführt, um die politisch-kulturellen Wunden - vor allem bei vielen ehemaligen Soldaten - zu beschreiben. Mit ihm lässt sich auch die Disposition zu nackter Gewalt besser verstehen, welche eine erhebliche Zahl von ehemaligen "Kriegern", Krumeich spricht von 400 000, in die politische Kultur der ersten deutschen Demokratie implantierte. Allerdings muss man sich der Voraussetzungen bewusst sein, unter denen ein solches Traumakonzept heuristische Erträge zur Erklärung innergesellschaftlicher Makrogewalt abwirft: Es muss die Prämisse akzeptiert werden, dass schwere psychische Erschütterungen kein rein individuelles Phänomen darstellen, sondern sich in die Disposition von Kollektiven einschreiben.
Neue Akzente setzt Krumeich auch hinsichtlich der symbolischen Beheimatung der Kriegsheimkehrer in der jungen Republik. Als exzellenter Frankreichkenner ist für Krumeich die Französische Republik der Maßstab, der offenbart, dass und wie ein dezidiert demokratisches Gemeinwesen die Frontsoldaten und Kriegsopfer mit symbolischen Gratifikationen versieht. Krumeich nimmt dabei zwei Kategorien aus dem soldatischen Sinnhaushalt ernst, die für das emotionale Ankommen der Heimkehrer in eine von Grund auf gewandelte politische Ordnung zentral waren: Respekt vor der "Ehre" wie vor dem "Opfer" der Frontsoldaten. Damit misst er die politische Leistung der frühen Weimarer Republik daran, ob sie die Leistungen der Heimkehrer in materiellen wie symbolischen Akten ansprechend gewürdigt habe.
Sein Urteil fällt eindeutig aus: Bis in die frühen zwanziger Jahre pflegte die Weimarer Republik keinen respektvollen symbolpolitischen Umgang mit den "Kriegern". Öffentliche Ehrungen seien bewusst vermieden und selbst ein reichsweites Denkmalsprojekt nicht realisiert worden. Die extreme politische Rechte und vor allem die Nationalsozialisten hätten dieses politische Vakuum leicht besetzen können, indem sie sich als die politischen Erben einer von der Republik schmählich im Stich gelassenen Frontsoldatengeneration profiliert hätten.
Krumeich stellt gerade zum Schluss seines Buches kritische Anfragen an die erste deutsche Demokratie. Diese sei nicht fähig gewesen, "eine Antwort auf die Niederlage zu finden, die den Hass und die Zerrissenheit zumindest teilweise hätte überwinden können". Dabei wahrt er stets die Proportionen im Urteil und neigt nicht dazu, sich in Seitenwege zu verrennen. Insofern zeugt sein Buch davon, wie ertragreich es sein kann, Anfang und Ende der ersten deutschen Demokratie neu zu beleuchten.
Gerd Krumeich: "Die unbewältigte Niederlage". Das Trauma des Ersten Weltkriegs und die Weimarer Republik.
Herder Verlag, Freiburg 2018. 336 S., geb., 25,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Hedwig Richter betont, dass Gerd Krumeich nicht dem Revisionismus betreffend Weimar das Wort reden möchte. Die Dolchstoßlegende umkreist der Historiker laut Richter ohne Hang zum Mythos. Auch wenn die Thesen und Ideen im Buch Richter nicht überraschen, Krumeichs Forschungsüberblick und seine Befassung mit dem "Trauma" Krieg, Niederlage und Friedensvertrag für eine kühle, präzise Analyse und Interpretation der Weimarer Republik scheint ihr unbedingt lesenswert.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH