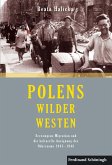Wie es den Westdeutschen nach 1945 gelang, Wege in eine demokratische, pluralistische Zukunft zu finden, ist eine der großen Fragen an die Geschichte der alten Bundesrepublik. Die Arbeit gibt neue und in manchem überraschende Antworten: Bedeutende Intellektuelle fanden keineswegs nur gegen, sondern häufig mit und durch die eigene Tradition in die neue Ordnung. Gerade darin liegt ein Grund für den Erfolg der Bonner Demokratie.Das Buch bietet eine umfassende Analyse intellektueller Strömungen in der Bundesrepublik von der unmittelbaren Nachkriegszeit bis in die 1970er Jahre. Manche Bereiche, wie die Geschichte der Zeitschrift 'Merkur', werden dabei zum ersten Mal überhaupt systematisch dargestellt. Über 20 Jahre nach der Wiedervereinigung werden so die ideengeschichtlichen Konturen der ersten drei Jahrzehnte des Bonner Staates in ihrem Facettenreichtum sichtbar.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Geschichte sieht anders aus, meint Carsten Kretschmann nach der Lektüre des Buches von Friedrich Kießling. Dabei nimmt sich der Autor laut Kretschmann durchaus Löbliches vor, indem er auf die Kontinuitäten in der deutschen Geschichte nach '45 abzielt. Allerdings klingt das, was Kießling schließlich aus den in der "Wandlung", im "Ruf", im "Merkur" und in den "Frankfurter Heften" geführten intellektuellen Debatten der 50er und 60er Jahre herausarbeitet, dem Rezensenten dann doch eher altvertraut als neu und aufregend. Dem Autor gelingt es laut Kretschmann nämlich weder die tatsächlichen Dimensionen der historischen Kontinuitäten zwischen Zweitem Weltkrieg, Drittem Reich, Weimarer und Bonner Republik herauszuarbeiten noch die Verschiebungen im Einzelnen zu erläutern. Darüber hinaus scheint dem Rezensenten das von Kießling abgesteckte Feld der genannten kulturpolitischen Zeitschriften dann doch viel zu begrenzt zu sein, um verlässlich Schlüsse ziehen zu können. Ideengeschichte ist dann doch ein viel weiteres Feld, meint der Rezensent.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Suche nach Ideen, die über 1945 hinaus- und in die Bonner Republik hineinreichten
Von der ominösen "Stunde null" ist in der Bundesrepublik nach 1945 mehr als einmal die Rede gewesen. Weil durch Krieg und Gewaltherrschaft alles zerstört worden sei, habe man buchstäblich vor dem Nichts gestanden. So lautet die Kurzfassung der erbaulichen Geschichte vom unbedingten Neuanfang. Sie ließ den rasanten Aufstieg Westdeutschlands umso respektabler erscheinen. Und auch die wunderbare Welt der Adenauer-Zeit funkelte vor diesem Hintergrund nur noch prächtiger. Genau das war der Effekt, auf den diese frühe Meistererzählung der Bonner Republik, an der einflussreiche Publizisten und Intellektuelle mitschrieben, angelegt war. Karl Jaspers betonte in seiner polemischen Wortmeldung "Wohin treibt die Bundesrepublik?" noch 1966, wie notwendig "Abbruch der Kontinuität, Distanz, der Sprung zum neuen Anfang" nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen seien.
Nun weiß die Geschichtswissenschaft nicht erst seit gestern, dass es den totalen Bruch selten gibt - aller Beschwörung des Neubeginns zum Trotz. Der Zauber, der allem Anfang innewohnt, mag mitunter vergessen lassen, dass Kontinuitäten stärker sein können als einzelne Zäsuren. Dies zu verdrängen ist therapeutisch gewiss heilsam. Die Aufgabe des Historikers besteht allerdings darin, im Wechsel alles Menschlichen auch das Bleibende zu ergründen. Insofern ist es naheliegend, dass Friedrich Kießling in seiner ideengeschichtlichen Studie gezielt nach den Kontinuitäten fahndet, die über die vieldiskutierte Epochenscheide 1945 hinausreichen. Er findet sie in den intellektuellen Debatten, die in den fünfziger und sechziger Jahren um Staat und Demokratie, das Problem der Moderne und geopolitische Konzepte kreisten.
Ein solches Vorgehen ist umso mehr zu begrüßen, als die Forschung lange Zeit den Akzent auf die historischen Brüche gelegt hat, die die junge Bundesrepublik vollzog. Das gilt etwa mit Blick auf die außen- und sicherheitspolitischen Weichenstellungen, die Konrad Adenauer gegen mancherlei Widerstände durchgesetzt hat. Erst recht gilt dies für die Annäherung an den Westen, die viel weiter reichte, als es der Siegeszug von Fastfood und Bluejeans im Nachhinein erkennen lassen. Denn der steigende Konsum von Coca-Cola und Hamburgern war nur Ausdruck einer inneren Transformation der Gesellschaft, die in ihren langfristigen Wirkungen gar nicht überschätzt werden kann. Was sich dabei Bahn brach, war eine deutsche Adaption jenes amerikanischen consensus liberalism, der sich seit dem New Deal zur neuen Staatsidee der Vereinigten Staaten entwickelt hatte. Ihre Grundbestandteile: Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Eigentumsgarantie waren aus deutscher Sicht zwar eigentlich alte Bekannte. Neu jedoch war der Umstand, dass der Konsensliberalismus nicht mehr der traditionellen Vorstellung eines Nachtwächterstaates anhing, sondern dem Staat eine aktive Rolle zubilligte - sowohl in der Wirtschafts- als auch in der Sozialpolitik.
Tatsächlich war der deutsche Wiederaufbau von Tradition und Innovation zugleich geprägt. Insofern rennt Kießling mit seiner These, die Bundesrepublik verdanke ihren Erfolg nicht unwesentlich dem Rückgriff auf politische Konzepte aus der Zwischenkriegszeit, im Grunde genommen offene Türen ein. Für eine Studie, deren Anspruch darin liegt, die "westdeutschen Ideenwelten" neu zu vermessen, ist das keine besonders günstige Voraussetzung. Es sind denn auch vor allem alte Bekannte, die dem aufmerksamen Leser begegnen. Ein "vieldimensionales historisches Bezugsgeflecht zwischen Zweitem Weltkrieg, Drittem Reich, Weimarer Republik und spätem Kaiserreich", so stellt Kießling heraus, habe die Bonner Republik geprägt. Was unzweifelhaft richtig ist, aber belanglos bleibt, solange nicht deutlich wird, welche Dimensionen konkret gemeint und wie die symptomatischen Verschiebungen innerhalb des Bezugsgeflechts zu erklären sind. Ob das anhand einer Inhaltsanalyse von vier kulturpolitischen Zeitschriften ("Die Wandlung", "Der Ruf", "Merkur", "Frankfurter Hefte") möglich ist, darf nach der Lektüre des Buches bezweifelt werden. Zumal zwei von ihnen bereits 1949 wieder eingestellt wurden.
Gewiss, es steht außer Frage, dass Ideen auch und gerade publizistisch greifbar werden. Indes: Die Publizistik ist ein weites Feld, und wer sich reifen Ertrag wünscht, muss es möglichst vollständig bestellen. Kießling richtet sich hingegen in einem Schrebergarten ein, mit akkurat gesäumten Wegen und sauber bepflanzten Beeten. Wo bleiben, so fragt sich der Leser inmitten dieser Idylle, die anderen kulturpolitischen Zeitschriften, die "Neue Rundschau" oder das "Kursbuch" etwa? Warum wird die Tagespresse nicht berücksichtigt? Wie steht es mit den auflagenstarken politischen Magazinen und Illustrierten? Weshalb werden Essays, Pamphlete und Ratgeber übergangen? Wieso fehlen Rundfunk und Fernsehen? Und warum spielen Filme, Theaterstücke oder Ausstellungen keine Rolle?
Ideen genügen sich nicht selbst. Sie werden symbolisch verdichtet, sie verstärken sich gegenseitig und konkretisieren sich in politischem Handeln. Dass sich von alledem in dieser Studie nichts findet, hängt freilich nicht nur mit ihrem eingeschränkten Quellenfundament zusammen. Es liegt auch an der Art und Weise, wie Kießling die Ideengeschichte betreibt. Zwar wird eigens Pierre Bourdieu bemüht, um dem Leser mitzuteilen, dass Ideen stets in einem sozialen Kontext stehen und bereits sozial konstituiert sind. Das Arbeitsprogramm, das sich daraus beinahe von selbst ergibt, wird jedoch nicht angemessen umgesetzt. Zwar ist gelegentlich von publizistischen Netzwerken die Rede. Und die Bedeutung Dolf Sternbergers wird am Beispiel seines Engagements für die "Wandlung" immerhin in Ansätzen deutlich. Grundsätzlich bleibt die gesellschaftliche Dimension der Ideen im Dunkeln. Über Freundschaften zwischen einzelnen Intellektuellen erfährt man ebenso wenig wie über Rivalitäten. Politische Absichten werden kaum thematisiert, ökonomische Interessen bleiben unerwähnt, und auch die öffentliche Wirkung interessiert Kießling nicht.
Dabei waren die Zinnen des Elfenbeinturms, in dem sich Kießlings Gewährsleute einrichteten, von beachtlicher Höhe. Nicht von ungefähr hat Hans Schwab-Felisch, ein bedeutender Publizist der frühen Bundesrepublik, bereits 1964 in einem Rückblick auf die Ära Adenauer konstatiert, man wisse "von keinem Schriftsteller, keinem Maler, keinem Musiker, keinem Geisteswissenschaftler", der sich eines "selbstverständlichen persönlichen Umgangs mit dem ersten Kanzler der Bundesrepublik hätte rühmen können".
Die Reichweite der Ideen, über die in den kulturpolitischen Zeitschriften lebhaft und selbstgewiss gestritten wurde, war begrenzter, als Kießling annimmt. Hinzu kommt, dass die ausgewählten Zeitschriften keineswegs das gesamte politische Spektrum abbilden. Zwar scheinen sich in ihnen, wie von Zauberhand, die vier "sozial-moralischen Milieus" zu artikulieren, die M. Rainer Lepsius idealtypisch rekonstruiert hat. Doch dient der Idealtypus ja in erster Linie dazu, die Abweichungen in der Wirklichkeit besser erkennen zu können. Von der Tatsache, dass sich unter den Beiträgern des vermeintlich durchgehend konservativ geprägten "Merkur" neben Gottfried Benn, Martin Heidegger und Carl Schmitt auch Theodor W. Adorno und Jürgen Habermas finden, kann nur überrascht sein, wer Schwarz und Weiß für die Grundfarben der Geschichte hält.
CARSTEN KRETSCHMANN
Friedrich Kießling: Die undeutschen Deutschen. Eine ideengeschichtliche Archäologie der alten Bundesrepublik 1945-1972. Verlag Ferdinand Schöningh, München 2012. 461 S., 58,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main