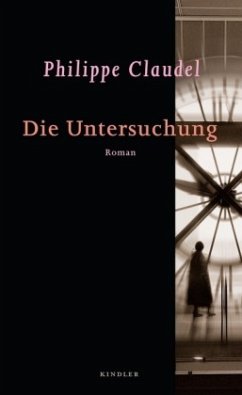Der Ermittler kommt in eine namenlose Stadt. Er soll in einem großen Unternehmen die auffällig zahlreichen Selbstmorde von Angestellten untersuchen. Von Beginn seines Aufenthaltes an scheint sich alles gegen ihn verschworen zu haben - es regnet, er findet kein Hotel, kommt zu spät. Im Unternehmen stößt er bei den Gesprächen mit Mitarbeitern nur auf Angst und Gehorsam.
Nichts wird klarer, stattdessen werden die Qualen des Ermittlers immer größer: Er wird der Spionage verdächtigt, eingeschlossen, macht verstörende Beobachtungen, aus denen er nicht schlau wird.
Mit beeindruckender stilistischer Klarheit erzählt Philippe Claudel diese Parabel auf die Entfremdung des Menschen in der modernen Welt.
Nichts wird klarer, stattdessen werden die Qualen des Ermittlers immer größer: Er wird der Spionage verdächtigt, eingeschlossen, macht verstörende Beobachtungen, aus denen er nicht schlau wird.
Mit beeindruckender stilistischer Klarheit erzählt Philippe Claudel diese Parabel auf die Entfremdung des Menschen in der modernen Welt.

Ein begehbarer Albtraum: In seinem Roman "Die Untersuchung" schickt der Franzose Philippe Claudel einen namenlosen Ermittler auf eine kafkaesk anmutende Reise.
Krieg, Gefangenschaft, Verbrechen, Einsamkeit, Sinnlosigkeit, Verzweiflung - mit Alltags-Kleinklein gibt sich Philippe Claudel nicht ab. Seit seinem international erfolgreichen Roman "Die grauen Seelen" (2004) stemmt er die allergrößten Themen-Gewichte. Auf fast jeder Seite erwecken die Bücher des 1962 geborenen Autors den Eindruck, Schreiben habe die unaufhörliche Bändigung der existentiellen Negativität zu leisten. Nie lassen sie Zweifel daran, dass mit der schlimmstmöglichen Wendung der Dinge zu rechnen ist. Denn der Mensch, der ist nicht so - nicht so, wie er sein sollte nach Maßgabe der Ethikkommissionen.
Bisweilen überdehnt Claudel, den manche für den wichtigsten französischen Romancier seiner Generation halten, das Pathos allerdings ins Melodramatische; schon im Finale der "grauen Seelen" und noch mehr in seiner Parabel "Monsieur Linh und die Gabe der Hoffnung". Umso erfreulicher, dass er im neuen Roman "Die Untersuchung" eine bei ihm bislang eher selten aufgetretene Qualität unter Beweis stellt: Komik. Eine Komik ist das allerdings, die all die dunkle Energie, die im Claudel-Kosmos flottiert, in sich aufgesogen hat. Manche werden sie vor lauter Schwärze womöglich gar nicht entdecken.
Ein unauffälliger Mann kommt bei miesem Nieselwetter in einer nichtssagenden Stadt an. Niemand holt ihn ab. Es handelt sich um den "Ermittler". Ein in jeder Hinsicht mittelloser Mann. Er hat nichts als seinen Mantel - und einen ominösen Auftrag. In der großen "Firma", die mit ihren krakenhaft wuchernden Gebäudekomplexen das Stadtbild dominiert, haben zwei Dutzend Mitarbeiter Selbstmord begangen. Der Ermittler soll die Hintergründe aufklären.
Aber so weit kommt es erst gar nicht. Denn in dieser Stadt hat sich alles gegen ihn verschworen. Es beginnt mit dem "Hotel Hoffnung", wo ihm nur nach langem Klopfen und Rufen geöffnet wird. Die Empfangsdame, eine übelgelaunte Riesin, lässt ihn erst einmal laut die Hausordnung vorlesen und stellt ihm anschließend dazu Verständnisfragen wie einem dummen Schüler ("Ist das Rauchen im Zimmer erlaubt?"). Dass die winzige Dusche entweder nur kochendes oder eiskaltes Wasser hergibt, mag noch der Realismus schlechter Reisen sein, ebenso das zugemauerte Fenster. Nicht jedoch der merkwürdige Anruf in der Nacht - ein verzweifelter Mensch fleht den Ermittler um Hilfe an.
Traumhaft schlecht ist das Frühstück am nächsten Morgen (zwei Scheiben Zwieback), während den plötzlich eingetroffenen Touristengruppen im Speisesaal ringsum Verwöhnportionen aufgetischt werden. In der drangvollen Enge wird dem Ermittler Kaffee über die Jacke geschüttet. Er geht zu den Toiletten - auf beiden Türen befindet sich das Frauen-Piktogramm. Trotzdem wäscht er dort seine Jacke aus; beim Versuch, das Rollhandtuch ein Stückchen herauszuziehen, lösen sich gleich die Schrauben des Handtuchhalters aus der Wand.
Wenig später bekommt es der Ermittler mit einem Polizisten zu tun. Der hält ihm vor, dass er einige Fragen zur Hausordnung nicht beantworten konnte und sich über das Frühstück beschwert habe. Und fügt beruhigend hinzu: "Sie brauchen keine Angst zu haben! Ich bin doch der Polizist, nicht der Mörder! Hier hat jeder seine Rolle!" Da klingelt das klobige Handy des Polizisten - und seine Miene erstarrt. Kurz darauf will er vom Ermittler wissen, warum er in die Damentoilette eingedrungen sei und den Handtuchspender mutwillig zerstört habe? Zur genauen Rekonstruktion des Tathergangs fordert er den Ermittler auf, in sein Büro zu kommen. Es befindet sich in der Besenkammer des Hotels - ein kleiner, improvisierter Schreibtisch zwischen Eimerstapeln, Putzlappen und einem riesigen Staubsauger.
Das alles klingt, nun ja, reichlich kafkaesk. Und so geht es weiter: Der Roman folgt einer abschüssigen Bahn ins Befremdliche und Surreale. Einige Kritiker haben Claudel deshalb Epigonalität vorgeworfen. Aber wieso eigentlich? In der Musik ist das variierende Spiel mit überliefertem Material selbstverständlich; die Kultur der Anspielungen, Zitate, Referenzen und Echos wird ohne Ende gepriesen. Claudel jedenfalls wirtschaftet mit den Kafka-Motiven auf eigenständige, eigenwillige Weise. Bemerkenswert ist der Einfallsreichtum, mit dem der Roman unerwartete Wendungen nimmt, so dass jede sich abzeichnende Logik der albtraumhaften Anderswelt immer aufs Neue durchbrochen wird. Sobald sich für den Ermittler ein bisschen Boden bildet, wird er auch schon wieder weggezogen.
Der minotaurushafte Wachmann, der gestern noch das abweisendste Gesicht aufgesetzt hatte, ergeht sich am nächsten Tag in sentimentalen Freundschaftsbekundungen und möchte den Ermittler dringend mal in die Arme schließen. Figuren wechseln ihre Rolle, und es überrascht nicht nur den Ermittler, dass er - nach all den Schikanen und Demütigungen durch das niedere Personal der "Firma" - von deren Chef schließlich mit ausgesuchter Liebenswürdigkeit empfangen wird. Auf die Frage, ob es möglich sei, etwas zu essen zu bekommen (seit dem Eintreffen in der Stadt ist dem Vermittler noch jeder Versuch, seinem hungernden Leib Nahrung zuzuführen, missglückt), antwortet der mächtige Mann: "Möglich?! Sie scherzen! Selbstverständlich ist es möglich! Darf ich Sie daran erinnern, wer Sie sind?" Ja, wer denn nur? Von der Selbstmordwelle hat der philosophisch veranlagte Chef allerdings noch nichts vernommen. Das habe man ihm wohl vorenthalten. "Meine Mitarbeiter wissen, dass man mich nicht verstimmen darf." Je länger der Ermittler dem Chef zuhört, desto mehr verstärkt sich der Eindruck, dass da ein riesiges Flugzeug ohne Pilot unterwegs ist. Auch das verheißene Essen trifft niemals ein - die Firmenkantine ist wegen Baumaßnahmen seit langem geschlossen.
Immer wieder fragt sich der Ermittler, ob er in einen begehbaren Albtraum geraten ist oder in eine neuartige Form der "Wirklichkeitsparodie", ob er halluziniert oder vielleicht schon gestorben ist, ohne es gemerkt zu haben, und sich in einem possenhaften Jenseits befindet. Das unterscheidet ihn allerdings von den Helden Kafkas, denen sich solche prinzipiellen Fragen nach der Seriosität ihrer Lebenswelt niemals stellen.
Wer die Wirklichkeit stark verfremdet, bekommt Schwierigkeiten, die Handlung zu einem Abschluss zu treiben, der Plausibilität - eine realistische Kategorie - beanspruchen kann. Nach einer fesselnden Lektüre potenzieren sich die Schrecknisse am Ende ins Unübersichtliche. Verstörung wächst sich zum Horror aus. Das platonische Höhlengleichnis wird zum Höllengleichnis, die Monadentheorie zum düstersten Container-Existentialismus: In einer öden, sonnenverbrannten Landschaft stehen die Behältnisse, Kästen, "mobile homes" - in jedem eingeschlossen ein Mensch, von dem nur dumpfe Schreie nach außen dringen. Bevor der Ermittler sich auflöst, wird ihm noch die Begegnung mit einer monströsen Figur zuteil: dem "Gründer", der an diesem Punkt nicht mehr bloß der ominöse Firmenpatriarch, sondern der Demiurg einer verfehlten Schöpfung ist. Der Roman verläuft sich in schwarzen Allegorien.
WOLFGANG SCHNEIDER
Philippe Claudel: "Die Untersuchung". Roman.
Aus dem Französischen von Ina Kronenberger. Kindler Verlag, Reinbek 2012. 222 S., geb., 18,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Um diesen Autor kennenzulernen, ist der vorliegende Roman das falsche Mittel, warnt uns Florian Welle. Dabei kann er Philippe Claudel absolut empfehlen. Dem Autor, bei uns noch ein Geheimtipp, wie Welle verrät, gereicht sein neuer Roman insofern nicht zur Ehre, als die Welle bereits bekannten Claudelschen Ingredienzien, wie die kafkaeske Orientierungslosigkeit des Helden, hier: eines Ermittlers, dessen Tappen im Dunkeln seiner Berufsbezeichnung spottet, leider allzu plakativ geraten. Die Bezeichnung Krimi mag Welle dem Buch ebensowenig geben wie er von einem realistischen Text sprechen mag. Dem Plot-Hintergrund der Selbstmordserie bei France Telekom zum Trotz. Da der Autor laut Welle diesmal kein Maß für seine literarischen Mittel findet, möchte er dem Leser Claudels frühere Romane empfehlen, "Die grauen Seelen? von 2004 etwa.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH