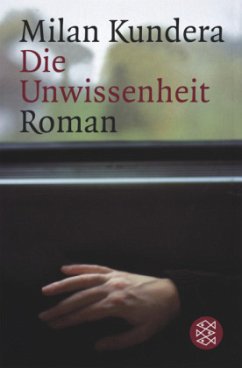Irena lebt seit zwanzig Jahren in Paris, sie hat Prag nach der russischen Besetzung 1968 verlassen. Doch für die Franzosen ist sie immer die Emigrantin geblieben. "Wieso bist du noch hier?", fragt ihre Freundin Sylvie nach dem Umsturz von 1989. Hat es die vergangenen Jahre überhaupt gegeben? Will niemand begreifen, daß die Jahre in Paris Irenas wirkliches Leben sind und nicht nur die verlorene Heimat? Und als sie nun zum ersten Mal Prag wieder besucht, merkt sie, daß sie auch dort nur die "Heimkehrerin" ist. Wie so oft in ihrem Leben hat Irena das Gefühl, dass die anderen ihr die Entscheidungen aus der Hand nehmen: Das Prag, das sie wiederfindet, ist nicht mehr ihre Heimat, das Paris, in dem sie lebt, will ihre Heimat nicht sein.
Doch da trifft Irena einen Mann, den sie zu kennen glaubt. War er es nicht, mit dem damals, vor vielen Jahren, eine Liebesgeschichte begann? Josef ist auch Emigrant, ihn hat es nach Skandinavien verschlagen, und plötzlich scheint es möglich, die Erfahrungen, die Erinnerungen miteinander zu teilen und ein neues, eigenes Leben zu beginnen. Doch kann man zwanzig Jahre überspringen, ja, ist im Leben etwas wie eine "Rückkehr" überhaupt möglich?
Milan Kundera erzählt von dem großen Thema der Heimat und Heimatlosigkeit. Und er erzählt davon, wie wenig man weiß von dem, was der andere erfahren und erlebt hat, wonach seine Sehnsucht, sein Heimweh eigentlich sucht.
Doch da trifft Irena einen Mann, den sie zu kennen glaubt. War er es nicht, mit dem damals, vor vielen Jahren, eine Liebesgeschichte begann? Josef ist auch Emigrant, ihn hat es nach Skandinavien verschlagen, und plötzlich scheint es möglich, die Erfahrungen, die Erinnerungen miteinander zu teilen und ein neues, eigenes Leben zu beginnen. Doch kann man zwanzig Jahre überspringen, ja, ist im Leben etwas wie eine "Rückkehr" überhaupt möglich?
Milan Kundera erzählt von dem großen Thema der Heimat und Heimatlosigkeit. Und er erzählt davon, wie wenig man weiß von dem, was der andere erfahren und erlebt hat, wonach seine Sehnsucht, sein Heimweh eigentlich sucht.

Schöner war es mit Calypso: Milan Kundera schreibt einen Roman über die mißlingende Heimkehr · Von Lothar Müller
Als 1989 die Mauern fallen und die Grenzen sich öffnen, wollen alle, daß Irena begeistert nach Prag zurückkehrt. Nur Irena nicht. Sie lebt seit zwanzig Jahren in Paris. Sie will von ihren revolutionsbegeisterten französischen Freunden nicht in die Mythologie der "Großen Rückkehr" abgeschoben werden. Und daß ihre Mutter sie nun so leicht besuchen kann, bringt sie der Welt, die sie verlassen hat, auch nicht näher. Die Rückkehr wäre womöglich wie die plappernde, nur am Eigenen interessierte Mutter: eine Zumutung. Die Emigrantin Irena schützt ihre Widerborstigkeit mit einer Maxime: Heimat ist da, wo man lebt, nicht da, wo man herkommt. Doch wie die Freunde läßt auch der Erzähler nicht locker. Irenas Geliebter, der reiche schwedische Geschäftsmann Gustaf, gründet ihr zuliebe für seine Firma in Prag eine Dependance. Kurz, der Erzähler nötigt sie zur Rückkehr. Was hat er mit ihr vor? Auffällig oft zitiert er das Urmodell aller Heimkehrergeschichten: die Odyssee. Sie verlangt, daß auch der zurückkehren muß, der nicht zurückkehren will.
Milan Kundera ist im Jahr 1975 nach Frankreich ins Exil gegangen. Seit den neunziger Jahren schreibt er seine Bücher auf französisch. In der Prager Burg residiert sein Gefährte und Rivale von einst, Vaclav Havel. Kundera ist in Paris geblieben. Seine tschechischen Bücher waren dick, selbst die verführerischsten schlanken Mädchen besaßen epische Fülle. Seine französischen Bücher sind schmal, selbst die Hauptfiguren haben darin etwas von luftigen Umrißzeichnungen. Ein leicht erhitzbares Erzähltemperament reibt sich auf der Suche nach seinem Altersstil an der kühlen, strengen Form der moralischen Erzählung. Manchmal mißlingen die Versuche, die alten Themen in die französische Hohlform umzugießen. So litt das mondäne französische Pendant zur böhmischen Liebesunordnung von einst in "Die Langsamkeit" (1994) am allzu demonstrativen und willkürlichen Zitat einer Novelle aus dem achtzehnten Jahrhundert. Das jüngste Alterswerk aber, "Die Unwissenheit", ist ein Ereignis. Mehr als zehn Jahre nach der "samtenen" Revolution kehrt der französische Erzähler Kundera nach Prag und in die böhmische Provinz, an die Schauplätze seiner tschechischen Romane zurück. Seine Figuren verlieren sich in der Welt von einst. Von ihnen bleibt am Ende nichts als eine Geschichte der mißlingenden Heimkehr.
Seit seinen Anfängen, vom Erstlingsroman "Der Scherz" (1965, erschienen 1967) bis zum Welterfolg "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins" (1984), läßt Kundera gern die Liebesunordnung und die politisch-historische Ordnung einander kommentieren. Mehr als jeder andere mitteleuropäische Autor hat er der Darstellung des Privatlebens im Ostblock den Grauschleier genommen: Der Sinnlichkeit seiner Figuren war durch keine Repression beizukommen. Seine Mythologie der Leichtigkeit schloß die Frivolität ein, den ironischen Attacken auf die Rhetorik des Konformismus leistete die lustvolle Darstellung der Liebesszenen Schützenhilfe, selten scheuten die männlichen Helden die Nähe zum Don-Juan-Klischee. In diesem schmalen Roman der Rückkehr läßt Kundera seine unwillige Irena nicht allein. Er führt ihr auf der Reise nach Prag einen Fast-Geliebten von einst in die Arme, der nach Dänemark ins Exil gegangen ist und seine Verwandten in einer böhmischen Kleinstadt besuchen will. Er gibt ihr seine Hoteladresse. Das muß so sein. Es kann in Kunderas Romanwelt keine Heimkehr nach Böhmen geben, in der nicht zumindest ein Liebesakt enthalten wäre.
Aber er läßt Irena und Josef erst einmal allein die mißlingende Heimkehr erleben und kehrt dabei seinerseits in die alte Rolle des satirischen Spötters und Chronisten der Lebenslügen zurück. Schnell entsteht im Gang der Erzählung ein kleines Kompendium des Mißtrauens und der Fremdheit zwischen den Weggegangenen und den Dagebliebenen. Irena hat ihren alten Freundinnen teuren französischen Wein mitgebracht, aber die betrinken sich lieber an böhmischem Bier. Josef begegnet am Handgelenk seines Bruders der Uhr und an der Wand dem Bild, das ihm ein Maler einst persönlich signiert hat. Das gemeinsame Elternhaus hat der Bruder günstig erworben. Das Gespräch mit dem alten Freund N., einem lauteren Marxisten, kommt erst freundlich in Gang, als die Politik daraus verbannt ist. Gustaf, der reiche Schwede, begeistert sich an dem idiotischen T-Shirt mit der englischen Aufschrift "Kafka was born in Prag".
Wer will, mag dieses Buch als Kunderas Abrechnung mit dem Egoismus und Opportunismus derjenigen lesen, denen die Emigranten bei der Heimkehr als fast Vergessene gegenüberstehen, mit denen man nicht mehr rechnet. Oder als elegische Attacke auf das kapitalistisch gewordene Prag, in dem die Allgegenwart der Werbesprüche die der Parteiparolen beerbt. Doch das Interesse des Erzählers für die unmittelbar politischen Dimensionen der Rückkehr aus dem Exil hat etwas von einer Pflichtübung. Er blickt auf die Erschütterungen des zwanzigsten Jahrhunderts zurück, als zitiere er sie nur noch aus Geschichtsbüchern.
Im ersten Exil-Roman Kunderas, dem "Buch vom Lachen und Vergessen" (1978), stand die Analyse eines Fotos am Beginn. Es zeigt den Parteiführer Klement Gottwald, der nach der Machtübernahme der Kommunisten im Februar 1948 vom Balkon eines Prager Barockpalastes zu den Bürgern spricht. Jedes Kind kannte dieses Foto. Also mußte es auffallen, als einige Jahre später in der retuschierten Fassung der neben Gottwald stehende Außenminister Clementis verschwand, nachdem er wegen "Hochverrat" hingerichtet worden war. In "Die Unwissenheit" gibt es solch prägnante Miniaturen historischer Physiognomik nicht. Gewiß ist die mißlingende Heimkehr der Protagonisten eine Spätfolge von Politik und Geschichte. Aber diese Geschichte ist ins nahezu Abstrakte verblaßt.
Ein Friedhofsbesuch öffnet Josef die Augen dafür, daß die Verwandten ihn auch dann in der Vergessenheit ließen, als er leicht zurückzuholen gewesen wäre. Auch über die nach 1989 gestorbenen Toten aus dem Familienkreis hat man ihm keine Mitteilung gemacht. Nicht nur in dieser Szene des Romans spielen die Toten eine Schlüsselrolle. Kundera hat sowohl Irena wie Josef mit dem Schatten eines Toten versehen. Irenas Mann Martin, mit dem sie emigrierte, starb bald nach der Ankunft in Frankreich. Josef hat seine dänische Frau verloren und es sich zur Gewohnheit gemacht, mit ihr wie mit einer Lebenden zu verkehren. Tote sind in Romanen Maschinen zur Produktion von Erinnerungen. So auch hier. Und zu den toten treten alsbald die noch lebenden ehemals Geliebten. Erschrocken beugt sich Josef über das Tagebuch seiner Jugend, das unfreiwillige Selbstporträt eines kleinen Dikators der Liebe. Je deutlicher dieser Emigrantenroman die politisch-historischen Dimensionen des Exils an die Peripherie rückt, desto mehr wandelt er sich in seinem Zentrum zum Roman der Erinnerung: Darin sind nicht die daheimgebliebenen Freunde und Verwandten die Fremden, sondern die abgelebten Metamorphosen des eigenen Ich.
Auch darin ist dieser Roman eine Rückkehr. Denn Kunderas Figuren, man denke nur an den Ludvik Jahn aus "Der Scherz", waren schon Heimkehrer, bevor sie Emigranten wurden. Die lustvolle Steigerung der Gegenwart durch die Liebesunordnung hatte stets in der Rückkehr an Orte der Vergangenheit ihr oft dunkles Pendant. In diesem französischen Buch nun, in dem Marcel Proust dem Emigrantenroman in den Weg gekommen ist, macht Kundera das Scheitern der Erinnerung zum Zentrum der mißlingenden Heimkehr. Leider zerfasert er dabei den novellistischen Kern seiner Idee dadurch, daß er sie allzu redselig ausplaudert. Zum einen in den essayistischen und etymologischen Abschweifungen über den Begriff der "Nostalgie", der überdies in der deutschen Fassung den unseligen Beigeschmack der Sentimentalität nie verliert. Zum anderen dadurch, daß er mit dem Modell der Odyssee so spielt wie ein routinierter Barpianist, der von seinem Publikum nicht viel hält: mit viel zuviel Pedal und ein wenig zu laut. Die Unwissenheit, die er im Titel trägt, verdichtet sich darin, daß Josef nicht weiß, wer die Frau eigentlich ist, mit der er einen ekstatischen Nachmittag erlebt. Irena hat ihn erkannt, aber er sie nicht. Er weiß nicht einmal ihren Namen. Durch ein Requisit aus der Vergangenheit wird er überführt. Besiegelt der Beischlaf in der Odyssee die gelingende, so hier die mißlingende Heimkehr. Das hätte der Leser auch ohne den Erzähler geahnt, der den Emigranten, bevor sie im Hotelzimmer der Liebe pflegen, ein dänisches Exemplar des Epos auf den Nachttisch legt, damit sie über Odysseus und Penelope reden können.
Wer darüber unwillig wird, ist zuvor schon mit einer kontrapunktischen Variation über die Macht der Erinnerung entschädigt worden. Darin ist die Narbe des Odysseus auf den Körper einer Nebenfigur gewandert. Milada, die Jugendliebe Josefs und Freundin Irenas, hat bei einem Selbstmordversuch aus Liebeskummer ihr linkes Ohr verloren. Sie verbirgt dies durch eine gegen alle Moden gleichbleibende Frisur und nimmt an keiner Liebesunordnung teil, damit ihr Geheimnis nicht offenbar wird. So geht sie als beiläufig geglückte Figur des Unglücks durch den Roman. Ebenso beiläufig wie sie findet darin die Sehnsucht des französisch schreibenden Autors nach seiner Muttersprache Eingang. Denn erst ein tschechisch geschriebener Roman Kunderas wäre ja ein Roman der Rückkehr im vollen Sinne. Kundera wird ihn wohl nie mehr schreiben. Für einen Schriftsteller, so mag er Irenas Maxime abwandeln, ist die Muttersprache nicht die Sprache, aus der er kommt, sondern die Sprache, in der er schreibt.
Aber das Tschechische spielt in diesem französisch geschriebenen Roman, den Kundera zuerst in der spanischen Übersetzung veröffentlicht hat, eine auffällige Rolle. Nicht nur, weil die Figuren in die Sprache zurückkehren, die ihr Autor verlassen hat, und sie vorsichtig wieder anprobieren wie ein lange abgelegtes Kleidungsstück. Sondern auch, weil die Schlüsselszene des Romans aus tschechisch gemurmelten Worten hervorgeht. Es sind obszöne, derbe Worte, durch die Irena den Liebesakt mit Josef herausfordert, als sie noch nicht weiß, daß er nicht einmal ihren Namen weiß. Vielleicht hat Kundera das Überkonstruierte, Unwahrscheinliche dieser Umkehrung der Beischlafszene zwischen Odysseus und Penelope nur um dieser tschechischen Worte willen in Kauf genommen. Zuvor, in seinen essayistischen Abschweifungen, wurde er nicht müde in der Ehrenrettung einer Rivalin der Penelope: "Calypso, ach, Calypso! Ich denke oft an sie. Sie hat Odysseus geliebt. Sie lebten sieben Jahre zusammen. Man weiß nicht, wie lange Odysseus Penelopes Bett geteilt hatte, aber bestimmt nicht so lange. Dennoch wird Penelopes Schmerz gerühmt, und Calypsos Schmerzen werden verspottet." Der Romancier Kundera lebt schon länger als sieben Jahre mit der französischen Sprache zusammen. Das Loblied auf Calypso kommt nicht von ungefähr. Doch obwohl er nie zu ihr zurückkehren wird, ist dies kein Roman gegen Penelope. Die Geschichte der mißlingenden Heimkehr ist zugleich die der Sehnsucht nach der verlassenen tschechischen Sprache.
Milan Kundera: "Die Unwissenheit". Roman. Aus dem Französischen übersetzt von Uli Aumüller. Carl Hanser Verlag, München 2000. 184 S., geb., 35,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main