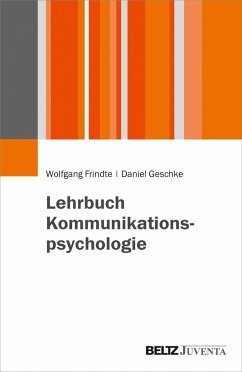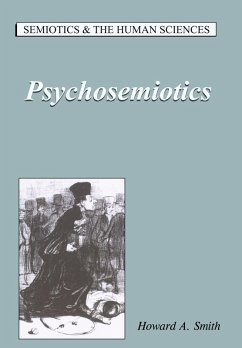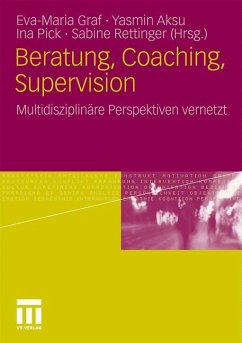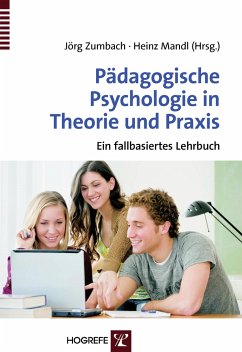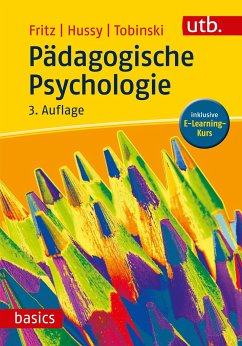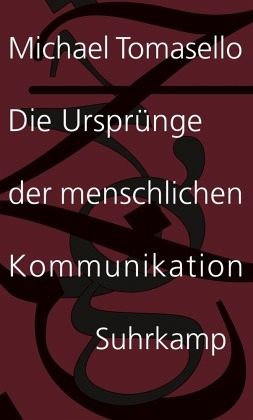
Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Menschen sprechen - im Gegensatz zu allen anderen bekannten Lebewesen auf diesem Planeten. Generationen von Wissenschaftlern haben sich an diesem bemerkenswerten Faktum abgearbeitet, Spekulationen über die Herkunft der menschlichen Sprache gibt es viele, aber bis heute keine überzeugende Erklärung. Mit Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation gelingt Michael Tomasello ein entscheidender Schritt zur Lösung dieses Rätsels.Gestützt auf reiches empirisches Material aus der Primaten- und Säuglingsforschung und die einflußreichsten Theorien der Sprachphilosophie sowie anhand einer Vielz...
Menschen sprechen - im Gegensatz zu allen anderen bekannten Lebewesen auf diesem Planeten. Generationen von Wissenschaftlern haben sich an diesem bemerkenswerten Faktum abgearbeitet, Spekulationen über die Herkunft der menschlichen Sprache gibt es viele, aber bis heute keine überzeugende Erklärung. Mit Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation gelingt Michael Tomasello ein entscheidender Schritt zur Lösung dieses Rätsels.Gestützt auf reiches empirisches Material aus der Primaten- und Säuglingsforschung und die einflußreichsten Theorien der Sprachphilosophie sowie anhand einer Vielzahl von schlagenden Beispielen aus der menschlichen Alltagskommunikation präsentiert er ein raffiniertes mehrstufiges Modell der Sprachentwicklung in individualgeschichtlicher wie auch artgeschichtlicher Perspektive. Zentrale Gelenkstelle in diesem Modell sind Gesten - Zeigen und Pantomime -, die sich im Zuge der Herausbildung sozialer Kooperation unter Primaten evolutionär entwickelt haben. In diesen Gesten erkennt Tomasello die Urformen der menschlichen Sprache. Um von diesen gestischen Vorformen zu einer komplexen sprachlichen Kommunikation zu gelangen, die dann kulturell kodiert, tradiert und verfeinert werden kann, bedarf es allerdings noch einer weiteren biologisch verankerten, aber exklusiv menschlichen Voraussetzung: einer »psychologischen Infrastruktur geteilter Intentionalität«. Diese sorgt dafür, daß Menschen ihre Wahrnehmungen und Absichten untereinander abstimmen und zum Bezugspunkt ihres gemeinsamen Handelns machen können. Der Mensch spricht, so könnte man sagen, weil er ein genuin soziales Wesen ist.