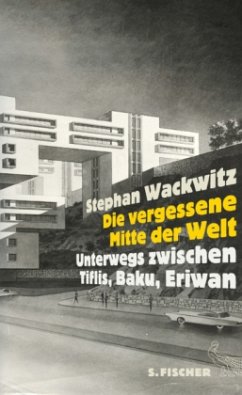Georgien und seine Nachbarländer Armenien und Aserbaidschan liegen am äußersten östlichen Rand Europas. Es sind uralte Kulturländer und zugleich höchst lebendige Staaten, die sich zwanzig Jahre nach ihrer Loslösung von der Sowjetunion auf einem kurvenreichen Weg in die Moderne befinden. Stephan Wackwitz, Leiter des Goethe-Instituts in Tiflis, erlebte in Georgien den Machtwechsel 2012 und beobachtet den alltäglichen Kampf um Demokratie und Menschenrechte. Er beschreibt, wie ein immenser Bauboom das Gesicht der Städte für immer verändert. Vor allem aber spürt er den besonderen Atmosphären im Herzen des eurasischen Kontinents nach, wo sich nicht nur Westen, Osten und Süden, sondern auch alle Zeiten magisch zu mischen scheinen.
"Die hier versammelten Stücke sind zwischen September 2011 und Juni 2013 in Georgien entstanden, einer Zeit, die hierzulande mehr und erstaunlichere Veränderungen mit sich gebracht hat, als man im Westen unter demokratischen Bedingungen für möglich hält. Besucher, die ein Jahr lang nicht mehr in Tiflis waren, erkennen das Straßenbild nicht wieder. Georgische Politiker, die 2011 fast allmächtig schienen, sitzen 2013 in Untersuchungshaft. Wir Bürger der reichen und freien Gesellschaften diesseits und jenseits des Atlantiks vergessen manchmal, dass Demokratie ein Experiment und der Ausgang von Experimenten offen ist. Der postsowjetische Transformationsprozess im Südkaukasus kann uns daran erinnern. Insofern ist dieses Buch nicht mehr als ein zeithistorischer Zwischenbescheid. Es besteht aus subjektiven Beobachtungen und Reflexionen eines ausländischen und sprachunkundigen fellow travellers während einer kurzen Etappe jener unsicheren und vielfältig gefährdeten Reise eines Landes, deren Ziele Demokratie und Moderne heißen. Ob und wie diese Ziele erreicht werden, ist nirgends ausgemacht. Und dauerhaft erreicht werden sie nie. Aber die georgische Gesellschaft ist aufgebrochen, und wenn ich mich auf meine politischen Intuitionen verlassen kann, war ich in den letzten beiden Jahren Zeuge der Selbstfindung eines neuen Mitglieds in der internationalen Familie der interessanten, widersprüchlichen, rührenden, neurotischen und kreativen Gesellschaften, die wir - wahrscheinlich in Ermangelung eines besseren Worts - als Demokratien bezeichnen." Stephan Wackwitz
"Die hier versammelten Stücke sind zwischen September 2011 und Juni 2013 in Georgien entstanden, einer Zeit, die hierzulande mehr und erstaunlichere Veränderungen mit sich gebracht hat, als man im Westen unter demokratischen Bedingungen für möglich hält. Besucher, die ein Jahr lang nicht mehr in Tiflis waren, erkennen das Straßenbild nicht wieder. Georgische Politiker, die 2011 fast allmächtig schienen, sitzen 2013 in Untersuchungshaft. Wir Bürger der reichen und freien Gesellschaften diesseits und jenseits des Atlantiks vergessen manchmal, dass Demokratie ein Experiment und der Ausgang von Experimenten offen ist. Der postsowjetische Transformationsprozess im Südkaukasus kann uns daran erinnern. Insofern ist dieses Buch nicht mehr als ein zeithistorischer Zwischenbescheid. Es besteht aus subjektiven Beobachtungen und Reflexionen eines ausländischen und sprachunkundigen fellow travellers während einer kurzen Etappe jener unsicheren und vielfältig gefährdeten Reise eines Landes, deren Ziele Demokratie und Moderne heißen. Ob und wie diese Ziele erreicht werden, ist nirgends ausgemacht. Und dauerhaft erreicht werden sie nie. Aber die georgische Gesellschaft ist aufgebrochen, und wenn ich mich auf meine politischen Intuitionen verlassen kann, war ich in den letzten beiden Jahren Zeuge der Selbstfindung eines neuen Mitglieds in der internationalen Familie der interessanten, widersprüchlichen, rührenden, neurotischen und kreativen Gesellschaften, die wir - wahrscheinlich in Ermangelung eines besseren Worts - als Demokratien bezeichnen." Stephan Wackwitz
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Mit Stephan Wackwitz hat Jörg Plath einen gebildeten Kosmopoliten vor sich, zwar leider ohne fundierte Kenntnisse in Georgisch, Russisch oder auch nur der russischen Literatur, aber das macht nichts, findet der Rezensent. Zumindest im ersten Teil des Essaybandes nämlich vermittelt ihm der Autor flanierend die Atmosphäre des Südkaukasus, höchst reflektiert und zugleich durchsetzt von einer gewissen Melancholie, wie Plath feststellt. Den Wendungen der Texte folgt er willig, bis er in Erewan und Baku landet, wo der Autor der Moderne und der Vormoderne zugleich begegnet und für den Leser gewinnbringend zwischen Traum und Wirklichkeit vermittelt (Plath denkt dabei an Benjamin und Aragon). Dass der Band im Weiteren zwischen Schwulenjagdszenen in Tbilissi und Bushaltestellenbetrachtung "ausfranst", hält Plath für bedauerlich, soziologisch, architektur- und mentalitätsgeschichtlich hat ihm der Autor da allerdings bereits nachhaltig imponiert.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Stephan Wackwitz ist unser Mann in Georgien. Der Leiter des Goethe-Instituts in Tiflis kennt die Menschen im Kaukasus, ihren Alltag - und ihre Sorge angesichts der übermächtigen Russen.
Längst haben die Kaukasusstaaten ihren Status als weltpolitische Eckensteher verloren. Nach dem Ende des Sowjetimperiums stehen sie vor der Aufgabe, sich in neu gewonnener Souveränität in den Bündnissen der Staatengemeinschaft als eigenständig zu positionieren. Ihr Abschied aus der erzwungenen Bedeutungslosigkeit erfolgt dabei im Schatten eines übermächtigen russischen Nachbarn, für den der Verlust seiner früheren Republiken wie ein Phantomschmerz wirkt, der Annexionswünsche wachhält und selbst militärische Interventionen nicht ausschließt. Ungelöste Territorialansprüche brechen immer wieder auf und machen die Region dauerhaft instabil.
Vielerorts bestimmt die archaische Logik der Rache das Verhältnis untereinander. Was nach außen beschönigend und ratlos deskriptiv als "frozen conflict" erscheint, erzeugt nicht mehr als eine gefährliche Selbstlähmung, wie etwa im Streit zwischen Aserbaidschan und Armenien um die Provinz Karabach deutlich wird. So zerklüftet wie das Gebirge, so brüchig sind die Beziehungen der Völker untereinander. Die folkloristisch gepflegte Vielfalt, in der sie sich infolge einer abstrus willkürlichen Siedlungspolitik unter Stalins Diktatur zu arrangieren hatten, verwandelt sich in Feindschaft, wenn der Stolz auf die eigene Nation nicht mehr ethnisch, sondern politisch zu artikulieren ist.
Politisch unerfahren, gewöhnt sich die Bevölkerung nur schwer daran, ihre gewählten Vertreter am erfolgreichen Durchsetzen von Kompromissen zu messen. Sie erwarten Heldentum und Kampferfahrung statt "Politik als Beruf" und halten von daher alles, seien es Personen oder Institutionen, für korrupt, was sich auf den öffentlichen Raum bezieht. Nicht verwunderlich ist es deshalb, dass die Staaten von einer Politik des Ausgleichs der Interessen, des Ausbaus demokratischer Teilhabe, einer minimalen wohlfahrtsstaatlichen Unterstützung der Armen sowie der Modernisierung ihrer Bildungseinrichtungen derzeit weit entfernt sind. Sie wären Voraussetzung dafür, den endemischen Bevölkerungsexodus, vor allem der akademischen Intelligenz, aufzuhalten.
Wie es angesichts einer forcierten Modernisierung der Gesellschaften um Alltagsnormen und Lebensgefühle der Menschen bestellt ist, welche Wege im Einzelnen aus der "Heiligkeit der Tradition" (Max Weber) genommen werden, ist von außen schwer einzuschätzen. Konsultiert man die heimische Literatur, stößt man auf Selbstverklärung und heroische Bergvölkerromantik. Die zarten Pflanzen des Tourismus, die in den Bergen des Kaukasus oder an den Küsten des Schwarzen Meers allmählich zu blühen beginnen, sind wenig geeignet, ein differenziertes Bild entstehen zu lassen. Sie bedienen die üblichen Klischees von kulinarisch unterstrichener Gastfreundschaft.
Unter den wenigen erhellenden Porträts der Mentalitäten jenseits der soziologischen oder politikwissenschaftlichen Expertise, aber auch in Abgrenzung vom touristischen Prospekt sticht die jüngst von Stephan Wackwitz vorgelegte Sammlung von Essays besonders wohltuend hervor. Wackwitz, gegenwärtiger Leiter des Goethe-Instituts in Tiflis, der seine früheren beruflichen Erfahrungen in Stationen von Tokio bis Krakau oder New York erfolgreich literarisch gewürdigt hat, liefert zu den drei Hauptstädten Eriwan, Baku und Tiflis aufschlussreiche ethnographische Porträts. Der Untertitel "Vergessene Mitte der Welt" rückt die geopolitisch brisante Lage, die Handelswege und den Brückenkopf der Region zwischen Orient und Okzident in den Blick und zeichnet die bei gleicher Lage unterschiedlichen kulturellen Eigenarten nach, mit denen die drei Länder ihren Weg in die Moderne suchen.
In Baku sind es die architektonischen Reste der Sowjetzeit, die mit den Monumentalbauten aus dem unverändert sprudelnden Ölreichtum ein bizarres Amalgam bilden, Kulisse für den Anspruch Aserbaidschans, einen schiitisch-islamischen Sonderweg und eine regionale Führungsmacht zu repräsentieren. In Eriwan geht er, inspiriert von der "Kaskade" genannten gigantischen Treppenachse, die die Stadt wie einen Radius teilt, den planerischen Motiven im geometrischen Exposé der Stadt nach, Spiegel des futuristisch starren Gestaltungsoptimismus des in Petersburg ausgebildeten Architekten Tamanjan aus frühkommunistischer Zeit. In Georgien registriert Wackwitz ohne ästhetischen Degout oder Voreingenommenheit das atemberaubende Tempo, in dem sich das Stadtbild von Tiflis verändert hat, initiiert vom "pharaonischen Furor" des georgischen Präsidenten Saakaschwili.
Originell interpretiert sind Bushaltestellen, geradezu verspielt anmutende idiosynkratische Beton-Überbleibsel aus der Sowjetzeit, die den Tausende Kilometer umfassenden Transit im großen sowjetischen Reich mit einem Symbol der Zugehörigkeit versahen.
Wackwitz, der Georgien und Tiflis den Großteil seiner Reflexionen widmet, erlebt zwei Gesichter georgischer Mentalität, den Enthusiasmus des "georgischen Traums", mit dem der charismatische Unternehmer Iwanischwili sein jahrelanges, entschieden eigenwilliges Engagement für den Aufbau der Infrastruktur organisatorisch bündelt, er erfährt jedoch auch vom Kräftepotential der georgischen Nationalbewegung, die in ihrem Kampf gegen die vorsichtigen Versuche diskriminierter Minderheiten, sich im Schlepptau der Modernisierung zu Wort zu melden, das archaisch kämpferische bis brutale Gegengewicht der normativ erschütterten Bevölkerung spürbar werden lässt.
Seit je hat der Kaukasus nicht nur Literaten fasziniert. Schon Ende des 19. Jahrhunderts lässt sich etwa Werner von Siemens von Land und Bevölkerung des Kaukasus berauschen. Vom Erfolg seines Unternehmens in der Elektrifizierung des Russischen Reiches ermutigt, scheut er das Abenteuer nicht, in Georgien in den Kupferbergbau zu investieren, unterlegt von der Phantasie, dem "stillen Sehnen nach den Urstätten menschlicher Kultur" zu folgen, wie er seinen Reiseerinnerungen anvertraut. Noch heute geben in einem der schönsten Stadtviertel von Tiflis zwei prachtvolle Villen Zeugnis von der Gewissheit, im Kaukasus das Paradies entdeckt zu haben.
Es ist ein Verdienst von Stephan Wackwitz, dem bleibenden Reiz der Region in einer beeindruckend präzisen historischen Tiefendimension nachgespürt zu haben. Seine Perspektive folgt der Tradition eines reflektierenden Essayismus, inspiriert durch seine essayistischen Vorbilder Walter Benjamin und Louis Aragon, im beobachtenden Duktus zwischen Abenteurer und Flaneur, vom Sozialtypus her somit aus der Position der Kaffeehausintelligenz. In dem fast immer angenehm zu lesenden Stil gelingen ihm treffsichere Vignetten aus dem Alltagsleben, die dank sorgfältiger historischer Recherche mit hinreichend analytischer Distanz und ethnographischer Genauigkeit die Besonderheiten einer sozialgeschichtlich wie weltpolitisch außerordentlich spannenden Region gekonnt herausarbeiten. Mehr als ein "zeithistorischer Zwischenbescheid", eher die gelungene Einladung zu einer Entdeckungstour.
TILMANN ALLERT
Stephan Wackwitz: "Die vergessene Mitte der Welt". Unterwegs zwischen Tiflis, Baku, Eriwan. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2014. 256 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Mit umfassender Belesenheit und Bildung macht Wackwitz sich ans landes- und gefühlskundliche Forschen, wodurch er Atmosphären und Architekturen überhaupt erst lesbar macht und analytisch erschließt. Eva Behrendt taz
Wackwitz erkundet die Städte als aufmerksamer urbaner Wanderer, der in seinem geistigen Gepäck historisches Wissen und eine hohe selbstreflexive Bildung mit sich führt. Karl-Markus Gauss Süddeutsche Zeitung 20140512