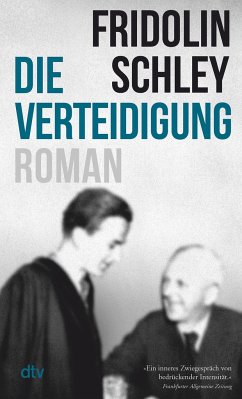Ein sprachmächtiger Roman über die Frage nach Gut und Böse
1947, die Nürnberger Prozesse: Einer der Angeklagten ist Ernst von Weizsäcker, SS-Brigadeführer und Spitzendiplomat unter Ribbentrop. Zu seinen Verteidigern zählt auch sein Sohn Richard, der vier Jahrzehnte später als Bundespräsident in seiner Rede vom 8. Mai über Kriegsschuld und die Befreiung Deutschlands vom Nazi-Gräuel sprechen wird. Eine historische Konstellation, die man kaum erfinden könnte: Hier stoßen das alte, schuldbeladene Deutschland und die gerade entstehende Bundesrepublik aufeinander. Mit literarischem Gespür nähert sich Fridolin Schley den historischen Figuren und umkreist die grundlegenden Fragen nach Gut und Böse, Schuld und Unschuld, emotionaler und moralischer Verpflichtung.
1947, die Nürnberger Prozesse: Einer der Angeklagten ist Ernst von Weizsäcker, SS-Brigadeführer und Spitzendiplomat unter Ribbentrop. Zu seinen Verteidigern zählt auch sein Sohn Richard, der vier Jahrzehnte später als Bundespräsident in seiner Rede vom 8. Mai über Kriegsschuld und die Befreiung Deutschlands vom Nazi-Gräuel sprechen wird. Eine historische Konstellation, die man kaum erfinden könnte: Hier stoßen das alte, schuldbeladene Deutschland und die gerade entstehende Bundesrepublik aufeinander. Mit literarischem Gespür nähert sich Fridolin Schley den historischen Figuren und umkreist die grundlegenden Fragen nach Gut und Böse, Schuld und Unschuld, emotionaler und moralischer Verpflichtung.

Fridolin Schley erzählt, wie Richard von Weizsäcker versuchte, seinen Vater zu verstehen.
Die Rede, die Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 zum vierzigsten Jahrestag des Kriegsendes in Europa hielt, war eine erinnerungspolitische Zäsur, die damals vielen im Lande nicht schmeckte. Zweieinhalb Jahre hatten sie auf die von Helmut Kohl angekündigte geistig-moralische Wende gewartet - und dann das: Der Tag der Kapitulation sei ein Tag der Befreiung gewesen, sagte der Bundespräsident. Für nicht weniger Irritation sorgte seine Feststellung, die Verbrechen der nationalsozialistischen Herrschaft seien nicht zu trennen vom Willen der Mehrheit der Deutschen, sie nicht zur Kenntnis zu nehmen: "Wer seine Ohren und Augen aufmachte, wer sich informieren wollte, dem konnte nicht entgehen, dass Deportationszüge rollten." Damit lag die Beweislast nicht mehr bei den Opfern. Jeder Deutsche, der das "Dritte Reich" bewusst erlebt hatte, musste jetzt glaubhaft machen, tatsächlich nichts gewusst zu haben.
Kritiker der Rede vertieften sich damals umgehend in Weizsäckers Familiengeschichte. Hatte nicht sein Vater, Ernst von Weizsäcker, als Staatssekretär im Auswärtigen Amt von 1938 bis 1943 zu den höchsten Beamten des "Dritten Reiches" gezählt? Im sogenannten Wilhelmstraßen-Prozess war er im April 1949 zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Sohn, Jurastudent im fünften Semester, hatte die Verteidigung vor dem Nürnberger Militärtribunal als Hilfsanwalt unterstützt, der von ihm als Zumutung empfundene Prozess lag seither wie ein Schatten über ihm. War es denkbar, dass der Bundespräsident mit seiner Rede das Schicksal des Vaters auf die gesamte Nation zu übertragen suchte, indem er das Trauma der Weizsäckers - mitgegangen, mitgefangen - zum Dilemma aller Deutschen erklärte?
Fridolin Schleys Roman "Die Verteidigung" spielt während jener anderthalb Jahre in Nürnberg, in denen der achtundzwanzigjährige Richard von Weizsäcker versuchte, die Dokumente der Anklage Punkt für Punkt zu entschärfen. Die Abläufe im Auswärtigen Amt seien komplex gewesen, in jedem einzelnen Fall gelte es, den besonderen Druck zu berücksichtigen, unter dem sein Vater gestanden habe. Wenn der Chefankläger Robert Kempner aber an einem bestimmten Punkt mit der stets gleichen Frage aufwartete, ob die Paraphe auf einem Schriftstück nun von Ernst von Weizsäcker stamme oder nicht, blieb diesem oft nichts als der Hinweis, die Qualität der Kopien sei zu schlecht, als dass er eine eindeutige Antwort geben könne, dafür müsste man ihm schon die Originale vorlegen: "Grundsätzlich war ich nur Briefträger in all den scheußlichen Angelegenheiten."
Der Wilhelmstraßen-Prozess sei "eine gigantische Materialschlacht" gewesen, die sich Anklage und Verteidigung geliefert hätten, wird Richard von Weizsäcker fünfzig Jahre später in seinen Erinnerungen schreiben und durchblicken lassen, dass 39 000 Seiten Beweismaterial mitnichten geeignet waren, die Entscheidungen, für die sein Vater zur Rechenschaft gezogen wurde, richtig zuzuordnen. Was der Wahrheitsfindung vor allem im Wege gestanden habe, sei das Ausmaß der Verbrechen gewesen: "Was über das Schicksal der Juden in den Vernichtungslagern bekannt wurde, erschütterte die ganze Welt. Es musste im Mittelpunkt der Nürnberger Prozesse stehen und zu Anklagen von ungeheurem Ausmaß führen." Man beachte die Setzung des Adjektivs. Ungeheuer ist nicht "das Schicksal der Juden", ungeheuer ist das Ausmaß der Anklagen, in deren Mittelpunkt sein Vater stand. Da "die ganze Welt" erschüttert war, schließt der Satz Vater und Sohn vermutlich mit ein - nur steht das da so nicht. Das "Ich" hat sich selten geschämt.
Im März 1942 musste der Staatssekretär Weizsäcker zur geplanten Deportation von sechstausend staatenlosen Juden aus Paris nach Auschwitz Stellung nehmen. Vonseiten des Auswärtigen Amts bestünden keine Bedenken, hieß es in der Vorlage des zuständigen Referatsleiters; Weizsäcker überkamen aber offenbar doch Bedenken, denn er formulierte neu: Das Auswärtige Amt erhebe keinen Einspruch. Wer solche Klippen sprachlich meistert, kann für die Brutalität der antijüdischen Maßnahmen des Regimes insgesamt nicht unempfindlich gewesen sein. Warum also blieb der Vater so lange auf seinem Posten? Während es in den von ihm abgezeichneten Rundschreiben, Schnellbriefen, Aktennotizen immer häufiger um das Eine ging - die Ausgrenzung, Abschiebung und Liquidierung der Juden Europas -, glaubte er offenbar, Schlimmeres verhindern oder wenigstens in Einzelfällen helfen zu können.
Schley ist, das liest man seinem Roman ab, überzeugt, dass selbst dem Sohn mitunter Zweifel gekommen sein müssen. Nicht am guten Willen und der grundsätzlichen Anständigkeit des Vaters, wohl aber an dessen politischer Urteilskraft. Konnte Ernst von Weizsäcker wirklich so blind gewesen sein, die Mechanismen der Vernichtungspolitik, zu denen regelmäßig eben auch die Zustimmung des Auswärtigen Amts gehörte, nicht zu durchschauen? Der Autor versetzt den Leser in die Situation des verzweifelten Sohnes, der seinem Vater um jeden Preis glauben will. Richard von Weizsäcker versucht im Roman unaufhörlich, die Zwangslagen des Vaters zu rekonstruieren und sich dessen Gewissensnöte auszumalen, scheitert aber ein ums andere Mal, weil sich das Verbleiben im Amt bis in den Sommer 1943 nach ethischen Kriterien einfach nicht rechtfertigen ließ.
In der Eröffnungsszene sitzt Richard von Weizsäcker einigermaßen zuversichtlich auf der Zuschauertribüne und verfolgt, wie sich der Gerichtssaal allmählich füllt: "Anstatt sich auf die Eröffnung und mögliche Widerworte zu konzentrieren, wird Richard sich fragen, ob sie alle hier im Saal nicht letztlich bloß Beteiligte am großen Drama der Geschichte sind, das sie zugleich übermannt." Am Ende, nach 250 Seiten, hat er "mit dem Vater, den er glaubte retten zu müssen, in Wahrheit die ganze Zeit gerungen". Um Worte, um Zeichen, um versteckte Andeutungen, mit denen der Vater seine Verteidigung hätte erleichtern können. Aber der blieb stolz und unzugänglich. Er schäme sich für das, was er "angerichtet" habe, notierte er einmal auf einem Zettel. "Richard wünschte, der Vater hätte nicht auch das in Anführungszeichen gesetzt."
Mit sicherem Gespür für den historischen Kontext, unter Verzicht auf überflüssige romanhafte Ausschmückung und ohne das moralische Auftrumpfen der Nachgeborenen entfaltet Fridolin Schley ein inneres Zwiegespräch von bedrückender Intensität. Mit seiner Entscheidung, sich an die Prozessakten zu halten und Richard von Weizsäckers Fragen an den Vater in erster Linie aus den in Nürnberg präsentierten Dokumenten zu entwickeln, ist der Autor ein hohes Risiko eingegangen. Je selbstbewusster der Vater die Motive seines Handelns vorträgt, desto hilfloser wirkt er. Aber soll der Sohn den Stab über ihn brechen, nur weil er seine Einflussmöglichkeiten maßlos überschätzte und nicht genügend Fantasie aufbrachte für das abgrundtief Böse in Hitler?
Am Ende versteht der Sohn den Vater so wenig wie zu Beginn des Verfahrens, aber er ist ihm nähergekommen - "umso mehr, als seine Taten ihn befremden". Der Leser, der sich auf die verstörende Dialektik dieser Perspektive einlässt, wird durch die Lektüre reich belohnt. Und kommt an einen Punkt, wo er ahnt, dass für den späteren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker der 8. Mai nichts anderes sein konnte als ein Tag der Befreiung - der Befreiung vom Alb eines übermächtigen, uneinsichtigen, schrecklich geliebten Vaters. THOMAS KARLAUF
Fridolin Schley: "Die Verteidigung". Roman.
Hanser Berlin Verlag, Berlin 2021. 272 S., geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension
Rezensent Hans von Trotha empfindet es als Glück, dass sich Fridolin Schley dieser Geschichte angenommen hat. Wie Richard von Weizsäcker 1948 den eigenen Vater bei den Nürnberger Prozessen verteidigte, was er dabei dachte und wie sein Vater agierte, erzählt der Autor laut Trotha retrospektiv als Geschichte über Schuld, Verantwortung und Gerechtigkeit, geschickt mit Erwartungen spielend, kafkaesk, nicht als historischen Roman. Schleys dezente Kontextualisierungen und der Einbezug von Dokumenten in den Text gehen dem Rezensenten durch Mark und Bein. Die Enttäuschung des Rezensenten darüber, dass Richard von Weizsäcker über seine Erfahrungen im Prozess nie Zeugnis ablegte, scheint das Buch zu mindern.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"'Die Verteidigung' gehört zu den aufwühlendsten Büchern dieses Herbstes. Es führt in atemberaubender Verdichtung jenen Moment vor Augen, in dem in Deutschland aus Wissenden angeblich Unwissende wurden." Julia Encke, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 15.08.21 "Der Roman hat eine unglaubliche Leidenschaft. Eine Leidenschaft der Aufklärung, der Nuance, des genauen Hinsehens. ... Wer ein bisschen für das Abenteuer des Denkens und Mitfühlens und nicht für schnellfertiges Denken gemacht ist, der wird ein riesiges Vergnügen daran haben. ... Und er wird eine sehr schwierige Situation der deutschen Geschichte so genau verstehen, wie man es bisher nicht konnte. Fridolin Schley geht näher heran als jeder andere bisher." Andreas Isenschmid, 3sat/Kulturzeit, 27.08.2021 "Mit sicherem Gespür für den historischen Kontext, unter Verzicht auf überflüssige romanhafte Ausschmückung und ohne das moralische Auftrumpfen der Nachgeborenen entfaltet Fridolin Schley ein inneres Zwiegespräch von bedrückender Intensität. ... Der Leser, der sich auf die verstörende Dialektik dieser Perspektive einlässt, wird durch die Lektüre reich belohnt." Thomas Karlauf, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.08.2021 "Eine atmosphärisch dichte Erzählung, die einerseits eng an den gesicherten Fakten und Dokumenten bleibt, andererseits aber kräftig Gebrauch macht von der dem Literaten ... jederzeit offenstehenden Möglichkeit, zu spekulieren und zu psychologisieren. Das Ergebnis ist beachtlich." Norbert Frei, Süddeutsche Zeitung, 13.08.2021 "In diesem ungeheuer dicht erzählten und lesenswerten Roman verschlägt es einem immer wieder die Sprache. Vor allem aber wird deutlich, es gibt nicht die Erinnerung, auf die sich irgendwann alle verständigen." Andreas Wirtensohn, WDR3, 28.12.2021 "Es ist, als habe Kafka nicht nur bei der Architektur des riesigen Justizpalasts sondern auch bei der des Verfahrens Pate gestanden, wenn Fridolin Schley davon erzählt. ... Die Dezenz, mit der Fridolin Schley seine Bögen schlägt, hat etwas Meisterliches. Und die Verbindungen, die er uns aus seinem Text herauslesen lässt, verleihen dem Roman seine eigentlich spannende Dimension. ... Es ist schade, ja ein Verlust für die deutsche Gesellschaft, dass Richard von Weizsäcker seine wahren Gedanken zu dieser Verteidigung nie hat teilen wollen. Für die deutsche Literatur unserer Tage war es eine Chance und Dank der Tatsache, dass Fridolin Schley sie ergriffen hat, so etwas wie ein Glück." Hans von Trotha, Deutschlandfunk, 28.09.2021 "'Die Verteidigung' ist ein Balanceakt zwischen Fakten und Fiktion, ein Justizdrama als Docufiction, ein Vater-Sohn-Szenario als Kammerspiel, das jede besserwisserische, anmaßende Geste vermeidet, das Fakten anbietet, aber eine gültige Wahrheit nie behauptet, Aufklärung im besten Sinne, in einer Zeit, in der es kaum noch Zeitzeugen gibt, von einem Autor der Urenkelgeneration, ein Generationenbuch also, ein Zwiegespräch zwischen den Generationen. Großartig!" Cornelia Zetzsche, BR Bayern2, 07.12.2021 "Schley, der an mehreren Stellen Bruchstücke aus der Rede in den Bewusstseinsstrom des jungen Richard ein_ießen lässt, kommt ohne jede wohlfeile moralische Überlegenheitspose des Nachgeborenen aus. In einer Zeit, in der Rufe nach neuen Formen der Gedenkkultur immer lauter werden, ist Die Verteidigung ein längst überfälliger Beitrag. Nicht nur weil darin kurzweilig und akribisch ein in die Gegenwart hineinwirkender Schlüsselmoment der deutschen Geschichte versinnbildlicht wird. Zudem wird mit unverbrauchten Mitteln eine alte, dennoch häufig verkannte Wahrheit demonstriert: 'Verstehen' und nuancierter psychologischer Nachvollzug bedeuten eben nicht automatisch zu entschuldigen. Vielmehr wird dadurch erst jene Distanz erzeugt, ohne die Erkenntnis nicht zu haben ist." Marianna Lieder, Zeit Online, 28.09.2021 "Es ist dies kein historischer, wohl aber ein historisch gründlich recherchierter, ein feinsinniger und intelligenter Roman, der seine Leser sensibel sowie mit hohem Respekt vor dem ehemaligen Bundespräsidenten mitnimmt in dessen inneres Zwiegespräch und innere Zwiespältigkeiten über Schuld und Gerechtigkeit, Verantwortung und Pflicht, Wahrheit und Lebenslüge. Richard von Weizsäcker hat sich zeitlebens nie öffentlich über seine Erfahrungen im Prozess geäußert. Für Fridolin Schley war diese Leerstelle eine Chance. Er hat sie gut genutzt." Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung, 30.01.2022 "Fridolin Schleys kluger, psychologisch feinfühliger und genau recherchierter historischer Dokumentarroman ist ein Gerichtssaal-Drama, das das 'große Drama der Geschichte' und das der Beteiligung daran verhandelt. ...Der Autor konfrontiert uns mit der Frage, wie der Einzelne und seine Familie mit der Schuld umgehen, die Weizsäcker durch seine Mitarbeit im nationalsozialistischen Verbrechensapparat auf sich geladen hatte. Fridolin Schley schreibt kühl, präzise und ohne jeden moralischen Überlegenheitsgestus des Nachgeborenen. 'Die Verteidigung' zeigt uns das Ringen um die Wahrheit als lebenslangen Prozess." Jurybegründung Tukan-Preis 2021 "[E]ine wirklich atemberaubende und hoch literarische Annäherung an dieses Vater-Sohn-Verhältnis. ... Schley gelingt ein wirklich dicht komponierter Text." Natascha Freundel, RBB Kultur, 19.01.2022 "Ein virtuos gewebtes Netz aus Fakt und Fiktion. Richards Fragen sind letztlich unsere. Das macht 'Die Verteidigung' gerade heute, wo die letzten Zeitzeugen bald gestorben sein werden und nach neueren Studien immer weniger Jugendliche über den Nationalsozialismus und seine Menschheitsverbrechen Bescheid wissen, zu einem eminent wichtigen Buch." Florian Welle, Münchener Feuilleton, Dezember 2021 "'Die Verteidigung' basiert auf einem beachtlichen Quellenstudium. Damit versetzt uns Fridolin Schley in die moralische Kälte der Nachkriegsgesellschaft: In atmosphärischer Dichte erleben wir, wie die gesellschaftlichen Eliten die Vergangenheit verdrehen und von Weizsäcker und sich selbst zu Widerstandskämpfern stilisieren." Eva Schmidt, ZDF, 12.12.2021 "Ein Stück Zeitgeschichte verlebendigt ... Schley schildert die zunehmenden Zweifel Richards an der Unschuld des lavierenden Vaters - und macht deutlich, wie schwierig die Suche nach einer Wahrheit ist." Antje Weber, Süddeutsche Zeitung, 10.12.2021 "Wie Fridolin Schley die Räume der Vergangenheit mit Leben füllt, und wie er sich dort im Denken der Weizsäckers und der damaligen Zeit umsieht, das ist hochspannend. Und dass er für den Wechsel aus erzählerischen und essayistischen Passagen den richtigen Rhythmus findet, macht seinen Roman auch sprachlich zu einem Genuss." Wolfgang Popp, ORF Ö1, 27.08.2021 "Ein Roman, der nicht nur einen profunden erzählerischen Blick auf die Entstehungszeit der Bundesrepublik wirft, sondern zugleich die ganz großen Themen in den Ring schleudert: Schuld und Unschuld, Opfer- und Täterrollen, Moral und Gewissen. ... ein großartiges, herausforderndes Buch, das nicht zuletzt aufgrund seiner exzellenten Sprache besticht." Sabine Zaplin, BR24, 08.09.2021 "Für mich ist das Buch dermaßen intensiv, dermaßen berührend, dass ich sagen würde, es ist eines der besten des Herbstes." Felix Münger, SRF1, 05.10.2021 "Eine meisterhaft geformte Sprache ..., eine große schriftstellerische Leistung." Jürgen Feldhoff, Lübecker Nachrichten, 13.11.2021