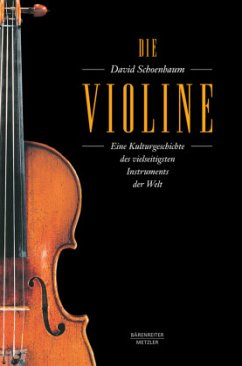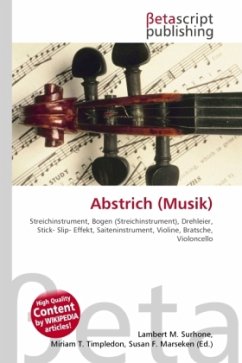Das von der internationalen Presse hoch gelobte Buch des bekannten Historikers David Schoenbaum erzählt die Lebensgeschichte der Violine: wie sie, gebaut, verkauft, gespielt und wie sie in der Kunst dargestellt wurde. Entstanden ist dabei eine höchst originelle Gesamtdarstellung. Die Violine ist vielleicht das flexibelste Instrument, das je erfunden wurde. Für Weltmusik, Tanzmusik und Indie-Rock ebenso geeignet wie für Bach und Beethoven, wird es seit jeher im Stehen oder Sitzen gespielt, allein oder in Gruppen, in Bars, Kirchen, Konzertsälen und Rumpelkammern, von Profis und Amateuren, Erwachsenen und Kindern, Männern und Frauen und auf jedem Kontinent. David Schoenbaum hat unzählige Details über Hersteller, Händler und Spieler der Violine zusammengetragen und in einer umfassenden Geschichte der Violine gebündelt. Von den ersten Anfängen, als Geigenbauer ihr Handwerk von Kistenmachern lernten, über Stradivari und das Goldene Zeitalter von Cremona, die die Geige zu einem begehrten Sammlerstück machten, bis hin zu unvergleichlichen Künstlern wie Paganini, Joachim, Heifetz und Oistrach informiert Schoenbaum sachkundig und mitreißend über Kunst und Kultur des vielseitigsten Instruments der Welt.

Das vielseitigste Instrument der Welt? David Schoenbaum streift mit Enthusiasmus durch die Geschichte der Violine und breitet dabei eine Fülle von Details und Forschungsergebnissen aus. So hilfreich wie ein Handbuch, aber besser zu lesen.
Von Eleonore Büning
Selbstverständlich führt die Ehefrau des Autors die Liste der Danksagungen an, ab Seite 646 ff. Aber sie hätte jeden Grund zur Eifersucht. Denn David Schoenbaum, Historiker und Amateurgeiger, ist seinem Gegenstand, mit dem er bereits im achten Lebensjahr bekannt gemacht worden war, so bedingungslos verfallen, dass er sich schon auf der zweiten Seite des Buches als ein Verliebter zu erkennen gibt. Er hat eine Hymne auf das Fräulein Violine geschrieben. In seinen Augen ist sie "das vielseitigste Instrument der Welt" - "the world's most versatile", wie es in der Originalausgabe heißt, die vor zwei Jahren herauskam.
Nun kann man bekanntlich mit einer Geige weder Kaffee kochen noch googeln. Auch mit anderen Musikinstrumenten, Klavier, Trompete oder Flöte, gelingt das schlecht. Aber ein Synthesizer ließe sich möglicherweise dazu umfunktionieren, und das Klavier kann immerhin ein ganzes Orchester ersetzen, eine Flöte dabei helfen, Hunde abzurichten oder Ratten zu fangen, und mit dem richtigen Trompetensignal zum rechten Zeitpunkt sollen schon Kriege gewonnen worden sein. All das kann die Geige nicht.
Und doch: Sobald wahre Liebe im Spiel ist, sind Superlative nicht nur gestattet, sondern geboten. Schoenbaum, der knapp zwanzig Jahre für diese Sozial- und Kulturgeschichte der Violine recherchiert hat und herrlich pointiert schreiben, gar das Florett der Selbstironie mit Eleganz führen kann, nutzt dies weidlich aus und füllt sein Vorwort mit den irrsten superlativischen Behauptungen.
Die Rede ist von einem Wunder. Quasi aus dem Nichts sei die Violine aufgetaucht, kurz nach der Entdeckung Amerikas und zeitgleich mit der Erfindung des Buchdrucks. Sie habe sich dann, "ebenso wie die Kartoffel", rasend schnell in Europa verbreitet. Ihren Siegeszug verdanke sie vor allem praktischen polyvalenten Eigenschaften. Sie sei, zum Beispiel, "tragbar, robust und erstaunlich zäh" und habe deshalb Autounfälle, Sturmfluten sowie Geiger überlebt, die sich draufsetzten (was man als Geiger nicht auf sich sitzen lassen möchte). Außerdem, schreibt Schoenbaum, wisse einzig die Violine zu singen wie eine Menschenstimme (was gewiss die Cellisten, Klarinettisten, Flötisten und Oboisten nicht auf sich sitzen lassen wollen), auch könnten Geigen "wie ein Baby" buchstäblich überall "gemacht werden", sie wären auch spielbar von jedermann, "stehend oder sitzend, an guten und an schlechten Tagen, auf jedem Breiten- oder Längengrad, zu jeder Tageszeit, solo oder in Gruppen, von Königen oder Bauern, Künstlern oder Alleinunterhaltern, Amateuren oder Profis, Erwachsenen oder Kindern, Männern oder Frauen, amerikanischen Sklaven oder leibeigenen Russen".
Lustig zu lesen! Und es lohnt sich, weiterzulesen, denn bald verdichtet sich der Tonfall ins Ernsthafte und Schoenbaum breitet die Fülle seiner Forschungsergebnisse aus. Im ersten Kapitel geht es um die Geschichte des Geigenbaus in Italien, Frankreich, Deutschland und Fernost, von den Anfängen in Brescia und Cremona, Absam und Füssen bis heute. Keineswegs entsprang die Geige in ihrer idealen Form eines schönen Tages, fertig wie Athene der Stirn eines einzigen Erfinders. Es kamen mehrere Faktoren zusammen. Bis in die Verästelungen der Familienstammbäume der Amatis oder Guarneris hinein schlüsselt Schoenbaum die Gründe für das Aufblühen des Geigenbaus in der Lombardei zu Beginn des sechzehnten Jahrhunderts auf. Selbst das Testament des Antonio Stradivari von 1729, das erst 1995 durch Zufall entdeckt wurde, wird befragt zu Kaufkraft, Familienstruktur und den Hintergründen einer Geldwirtschaft, wie sie das kulturelle Prosperieren der Patrizierstädte erst ermöglichte. Manche Geschichten aus dieser Geigengründerzeit lesen sich wie Kurzkrimis. Und selbstredend unterschlägt Schoenbaum nicht die diversen Vorläufer und Konkurrenten der Geige, welche zunächst aus dem Feld zu schlagen waren: Gambe, Laute, Rebec, Fidel.
Das zweite Kapitel ist gleichfalls eine Staffel ulkiger Kriminalfälle, ergänzt durch Gerichtsreportagen. Es befasst sich mit der Frage, wie sich das Handeln mit alten Geigen zu einem Gepoker um so gigantische Geldsummen entwickeln konnte, dass parallel dazu auch das Geschäft mit Kopien und Fälschungen aufblühte. Schließlich geht es, drittens, um Geigenspiel und Geigenspieler (nebst Exkurs zur historischen Aufführungspraxis) sowie, viertens, um die Rolle der Geige in Kunst, Film und Literatur, mit Schwerpunkt auf amerikanischer Belletristik.
Womit sich Schoenbaum nicht befasst: mit Kompositionen für Geige. Womit er sich dankenswerterweise ausführlich befasst: mit der Geschichte des Geigenbogens, von Tourte bis Pfretzschner. Schließlich wäre ohne einen exzellenten Bogen selbst eine Guarneri nichts weiter als "eine viersaitige Gitarre". Und wenn schon die alten Geigen heute unbezahlbar sind und man sich zu seinem Pfretzschner-Bogen eine neue anschafft, dann sollte es wenigstens keine der industriell gefertigten sein, sondern eine in Manufaktur gebaute, zum Beispiel aus der Nachwendezeit, aus Marktneukirchen.
Was auch Schoenbaum nicht erklären kann, ist das Mysterium, warum alte Geigen besser klingen, voller und süßer, wenn sie viel gespielt werden. Und warum ist eine alte besser als eine neue? Gibt es ein Geheimnis des Lacks, ist der Lack ganz egal? Auch zu dieser Frage gibt es allerhand Meinungen, Thesen und Indizien, nur keine letzte Gewissheit. Eine echte Stradivari oder del Gesù allein am Klang erkennen zu wollen ist jedenfalls ein Hokuspokus, an dem selbst große Geigenvirtuosen wie Pinchas Zukerman oder Isaac Stern scheiterten, bei jenem berühmten Blindtest, den die BBC anno 1977 veranstaltete.
Anekdote folgt auf Anekdote. Schoenbaum plaudert, er verplaudert sich, zweigt ab, verirrt sich auf seltsame Nebenschauplätze, streift alte Fragen, findet junge Trüffeln, was alles die Leselust freilich nur noch mehr befeuert: Man muss kein aktiver Geiger sein, um ihm gern durch dieses tönende Labyrinth zu folgen.
Was den baren Informationswert anbelangt, so steht Schoenbaums Buch einem zünftigen musikwissenschaftlichen Nachschlagewerk, etwa dem vortrefflichen, von Stefan Drees betreuten "Großen Lexikon der Violine", das soeben im Laaber-Verlag in dritter, revidierter Auflage herauskam, kaum nach. Das Personenregister ist hilfreich, ein Sachregister noch dazu wäre sicher von Nutzen. Als Liebeserklärung an die Geige aber wirkt das Buch wie ein Pendant zum Roman des Klaviers, den Dieter Hildebrandt Anfang der Achtziger verfasste, mit großem Erfolg; wie ja überhaupt oftmals die schönsten Fachbücher von den Liebhabern, nicht von den Profis geschrieben werden.
Und selbst der Fachmann, der sich gut auskennt mit Violinen, mag Neues erfahren aus diesem Buch. Zum Beispiel: Dass ein amerikanischer Flieger sich in deutscher Kriegsgefangenschaft eine Violine aus Bettlatten baute. Ob er sie spielte und wie, auch wie sie klang, darüber wird nichts weiter mitgeteilt. Aber wenn einer schlecht Geige spielt, krächzt auch eine Stradivari wie eine schlecht geölte Tür.
David Schoenbaum: "Die Violine". Eine Kulturgeschichte des vielseitigsten Instruments der Welt.
Aus dem Amerikanischen von Angelika Legde.
Bärenreiter / J. B. Metzler Verlag, Stuttgart 2015. 730 S., Abb., geb., 49,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Angela Schader erfährt unendlich viel aus David Schoenbaums im amerikanischen Original 2013 erschienenen Buch über die Violine. Was der Historiker an Fakten über und um das Instrument zusammenträgt, ergänzt die Fachliteratur und hebt sich zugleich von ihr ab, meint Schader. Ob Geigenbau, Geigenhandel, Intrigen, Spielkultur und Interpreten, Geigen in der Literatur, alles erkundet und vermittelt der Autor ihr mit Neugier und einem Wissen, das politische, soziale und wirtschaftliche Bezüge miteinfließen lässt. Da der Autor zügig und unaffektiert schreibt, wird die Stofffülle für Schader nicht zur Last, sondern zur mitunter höchst spannenden Erfahrung.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH