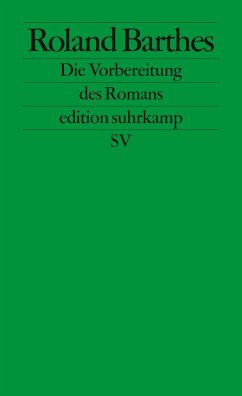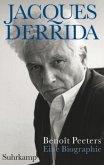Im April 1978 beschließt Roland Barthes, einen Roman zu schreiben, kommt aber über Stichworte nicht hinaus. Die Erfahrung dieses Scheiterns macht er in den folgenden Jahren zum Thema der theoretischen Arbeit: Er widmet dem Übergang "vom Schreiben-Wollen zum Schreiben-Können" zwei Vorlesungen am Collège de France. Darin geht er der Frage nach, wie aus verstreuten Ideen ein Textkontinuum entsteht, das einen "Realitätseffekt" erzeugt. Er behandelt aber auch, am Beispiel von Proust, Flaubert und Tolstoi, den Prozeß des Schreibens sowie die "diätetischen Regeln", denen sich die Autoren unterwerfen - die Einsamkeit, die Nacht, die Stimulanzien ...

Die letzten Vorlesungen von Roland Barthes handeln vom Wunsch, Schriftsteller zu werden
Zwei Tage nach dem Ende der Vorlesungen, die jetzt unter dem Titel "Die Vorbereitung des Romans" erschienen sind, also am 25. Februar 1980, wurde Roland Barthes, den man einfachheitshalber einen Kulturwissenschaftler nennen kann, vor dem Collège de France, wo er die Vorlesungen hielt, von einem Auto erfasst. Er starb einen Monat darauf im Krankenhaus, im Alter von 63 Jahren. Dieser Tod ist rückblickend um so merkwürdiger, als Barthes am 15. April 1978, es war ein trüber Nachmittag in Marokko, von einer Erleuchtung heimgeholt worden war. Es war, in seinen Worten: "eine Art Satori, ein Aufblitzen".
Die graue Gegenwart wurde mit einem Mal von einem Licht überblendet, in dem er sich vor einer verlockenden Aussicht wiederfand. Es sah aus wie eine Erlösung: Er könnte dem Collège und den Vorlesungsverpflichtungen den Rücken kehren und sich ganz dem Schreiben widmen, das ihm die Erfüllung einer großen Lust versprach. Ein Mittelweg tat sich auf, als hätte die Vernunft ein Machtwort gesprochen. Denn die Dichotomie von Vorlesungstrott hier und Schreibfreiheit dort ist unmittelbar darauf in einer Idee zusammengeschmolzen, die Barthes' bisherigem Lebenslauf mehr zu entsprechen schien: Er wollte Vorlesungen über das Schreiben eines Romans halten. Genauer gesagt: die Vorlesungen selber als die Vorbereitung des Romans verstehen, den er zu schreiben hoffte. Das hieß nun, und zwar nicht in der feinen Sprache Roland Barthes', zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen.
Der berühmte französische Wissenschaftler sah sich damals, in jener erleuchteten Zeit, in der Mitte des Lebens angekommen. Er stand dort, wo es einem so vorkommt, als würden die Tage gezählt, als könne der Entschluss nicht mehr aufgeschoben werden, das Leben wirklich zu ändern.
Urgrund des Begehrens
Sein Leben ändern: das hieß für Barthes, der gut Klavier spielte, beim Schreiben andere Wege einzuschlagen. Den Schreibstil nahm er in einem ganz emphatischen Sinne als ein Mittel wahr, subjektiv er selbst zu sein. Eine Wahl, die insofern nicht überrascht, als er, der sich mit seinen kulturkritischen Büchern rasch einen Namen gemacht hatte, selbst eine Hochspannungsleitung gelegt hatte, die von einem unhinterfragbaren Begehren zu dem aus diesem Urgrund folgenden Text reichte. Damit hatte er einen folgenreichen Zusammenhang hergestellt, den er analytisch immer wieder ausdeutete.
Die Vorlesungen über die Vorbereitung des Romans kann man als eine Fort- und auf den Schriftsteller zugeschnittene Engführung der Studie "Die Legende vom Künstler" lesen, die Otto Kurz und Ernst Kris 1934 vorgelegt hatten. (Das Buch wird in der Bibliographie der Vorlesungen nicht erwähnt.) Sie sollten den Sprung vorbereiten, mit dem Barthes zu gelingen hoffte, was ihm nicht gelang: der Seitenwechsel von der Theorie zur Praxis der Kunst - des Romans. Er blieb diesseits des Grabens. Man kann das tragisch nennen. In den Vorlesungen hört man von dieser Tragik vorderhand wenig. Barthes scheint im Grunde guter Dinge zu sein, er hat sich verguckt in die Aussicht, dass ihm das Neue gelingen wird. Keine Klagen ziehen wie Schwaden dahin.
Im Gegenteil. Mit lebenszugewandter Neugier breitet er, gleich einem Weltreisenden aus dem neunzehnten Jahrhundert, Erfahrungen, Erkenntnisse und Ahnungen aus dem Reich der Buchstaben, der Literatur und des Schreibens aus. Dank dieser kenntnisreichen Intimität entsteht eine Atmosphäre, die man in den hohen und trotz ihrer bürgerlichen Weitläufigkeit abgeschlossen wirkenden Arbeitsräumen von Schriftgelehrten erwartet. Wer würde hier, vor den ledernen Buchrücken der Tradition, vor Verzweiflung aufzuheulen wagen?
Und doch geht wie die alte, Regen und Kälte bringende Frau Herbst, eine stille Verzweiflung durch die sommerlich anmutenden Vorlesungen. Sie wird vorangetrieben von dem Wissen, dass die sich über zwei Jahre hinziehenden Vorbereitungen für die eigene literarische Kunst wahrscheinlich im Sand steckenbleiben werden. Barthes' Insistieren auf dem Schreibbegehren und auf dem Text wird zwar von der zum Teil berechtigten Hoffnung angestachelt, aus der Objektivität der Wissenschaft durch einen eigenen, subjektiven Schreibstil ausbrechen zu können. Doch dieses Insistieren führt zum Stillstand - ein, zwei, doch entscheidende Meter von der Poesie entfernt. Ein Stillstand, der durch die prozessual (das Begehren) und genreübergreifend (den Text) gefassten Kategorien hätte vermieden werden sollen. Ein Lebenswerk, so scheint es, kann auch darin bestehen, jene Schlingen auszulegen, aus denen das Werk und das Leben nicht mehr herauskommen.
Dass Wissen und Poesie durch die Sprache als ihrer beider Ausdrucksmittel verbunden sein müssen - diese auf der Hand liegende Unterstellung scheint bei Barthes (und nicht nur bei ihm) die Erwartung genährt zu haben, es sei eine Art fließender Übergang zwischen beiden Sphären möglich. Kein Maler würde vor den Farben, kein Musiker vor den Tönen eine solche Strömungslehre aufstellen.
Die Vorstellung eines fließenden Übergangs verstellt Barthes nicht die Einsicht, dass der Weg von hier nach dort langwierig und beschwerlich sein wird. Der Philologe, der einen Roman schreiben möchte (sicherlich keinen schlichten Roman wie ihn der Philosoph Peter Bieri unter dem Namen Pascal Mercier veröffentlicht hat), ist sich seiner Mittel nicht sicher. Sich an einen Roman der Vergangenheit wie Marcel Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" zu machen - Barthes scheut den Griff in den siebenten Himmel nicht -, erlaubt ihm sein in dieser Hinsicht schwaches Gedächtnis nicht.
Bleibt ein Roman der Gegenwart. Dessen Anfänge bilden für den literarischen Novizen die Notate. Vorbilder für diese sinnerfüllte poetische Kurzform findet er in den Haikus. Sie ragen wie ein rettender Strohhalm aus dem Meer der Zeichen. Ihnen widmet er lange Ausführungen, die schließlich in der Forderung einmünden, das Notieren als Schreibpraxis zu pflegen und Notizhefte zu führen. Solche Anregungen werden ergänzt durch eine Fülle von Skizzen über den psychosozialen Habitus, der Schriftstellern zu eigen ist, die es ernst mit ihrem Werk meinen. Das reicht vom Tagesablauf bis zur Inszenierung als Heiliger.
Damit steht die Bühne der Poesie. Die Requisiten stammen vor allem aus dem Leben und dem Werk Kafkas, Mallarmés, Flauberts, Chateaubriands, Prousts, teilweise Rimbauds. Neue amerikanische Schriftsteller, Thomas Pynchon zum Beispiel, tauchen in diesem klassisch- modernen Arrangement nicht auf. Diese auffällige Beschränkung beschreibt Barthes als "eine Art von Fixierung, von Regression auf das Begehren einer bestimmten Vergangenheit". Er mag die deutsche Romantik mit ihrem Faible fürs Fragment und für ihre Auflösung der Grenzen zwischen Wissen und Poesie. Der Graben zwischen dem Dichter und dem begehrenden Betrachter klafft auch hier auf. Dem jungen Friedrich Schlegel gelang immerhin mit "Lucinde" ein bedeutsamer Roman.
Ein Werk in C-Dur
Barthes' Aufbruch in eine romantische Textlandschaft mag man als einen Reflex auf die von ihm diagnostizierte lawinenhafte "Schreiberei" verstehen. Er hat dafür auch das Wort "universelle Reportage" geprägt. Mit Verve setzt sich die "Schreibweise des Schriftstellers" davon ab. Die ausufernde Sprache des Journalismus enthalte, so Barthes, "nichts Archaisches, keinen Ursprungssinn, kein (sprachliches) Ritual, keine Liturgie, kurz: nichts Religiöses". Der wahre Schriftsteller steht sprachlich im Abseits. Der Gegenstand seines Begehrens, das sind Barthes' letzte Worte in den Vorlesungen, sei: "ein Werk in C-Dur zu schreiben". Wem fiele nun nicht Peter Handke ein, dessen "Stunde der wahren Empfindung" zu Beginn der Veranstaltung auf Französisch vorlag? Barthes, dem es nicht gelingt, das Werk in C-Dur zu schreiben, bleibt nichts anderes übrig als zu warten.
Er wartet auf einen "Auslöser, eine Gelegenheit, eine Verwandlung: ein neues Hören der Dinge". Man beachte den Wechsel im Register der Zeichen: Hören statt Schreiben, als würde er seiner Strömungslehre im letzten Satz misstrauen. Es fehlt Entscheidendes, um ein Dichter zu sein. Das Begehren, dem Barthes alles zutraut, vermag den Abstand nicht zu überbrücken.
Insofern kann man diese lehrreichen Vorlesungen über das Drama des Schriftstellers, in dem psychoanalytisch hochschwangere Figuren wie das Ich-Ideal und das Ideal-Ich auftauchen, als einen wehmütigen Versuch lesen, die Grenzen seiner selbst zu akzeptieren - eines glänzenden philologischen Analytikers - und der Analyse im Allgemeinen. Grenzen, die das Begehren wegschwemmen sollte. Das Begehren, mit dem er sich an die Dichter schmiegt und das er zugleich zu einer das Reich der Texte durchströmenden universellen Kraft presst, scheint gerade die Essenz gewesen zu sein, die ihn von jenen absonderte, denen er anzugehören hoffte.
Um kurz zu sagen, was als Lebenswahrheit schwer zu verkraften ist: Die Analyse des Begehrens ist nicht das Begehren. Die Vorbereitung des Romans ist nicht der Roman. Roland Barthes, wie er sich in seinen letzten Vorlesungen darstellt, muss ein manchmal strenger, grundsätzlich freundlicher, ja mitunter gütiger, letztlich aber still verzweifelter Mensch gewesen sein. Ein Mensch, der mit einem Mal feststellen musste, dass er die Mitte des Lebens nicht nur erreicht, sondern längst überschritten hatte. "Vita Nova" sollte sein Roman heißen.
EBERHARD RATHGEB
Roland Barthes: "Die Vorbereitung des Romans". Aus dem Französischen von Horst Brühmann. Suhrkamp-Verlag 2008, 570 Seiten, 18 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Für Manuel Karasek ist Roland Barthes mit diesem Buch endgültig im Olymp der aphoristischen Meisterdenker angekommen. Barthes' erstmals auf Deutsch vorliegende letzte Arbeit imponiert dem Rezensenten wegen ihres in Exkursen und eher unauffälligen Gedankengängen unvermittelt sich bahnbrechenden Geistreichtums. Wie der Autor seine Lektüre von Prousts "Recherche" als Theorie ihrer eigenen Entstehung und autobiografische Versuchsanordnung mit seinem eigenen Versuch, einen Roman zu schreiben und außerdem mit einem kulturhistorischen Vergleich zwischen Roman und Haiku verzahnt, findet Karasek subtil und aufregend. Hat der Rezensent beim Lesen auch oft den Eindruck des Unfertigen, Notizhaften des Textes, so empfindet er schließlich doch das Glück, einer "katalogisierenden Überprüfung literarischer und philosophischer Ideen" beizuwohnen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Barthes entdeckt die Literatur neu als Drama des Wunsches zu schreiben, seiner Finessen, seiner Listen und Verwegenheiten: alles sagen zu wollen oder sich ins Schweigen zurückzuziehen ... « Henning Ritter Frankfurter Allgemeine Zeitung