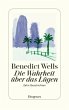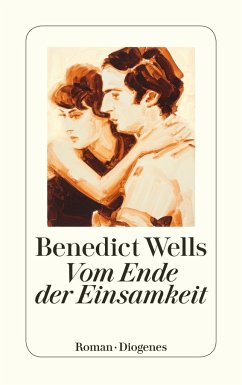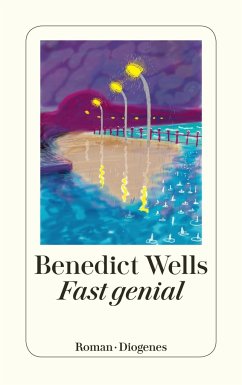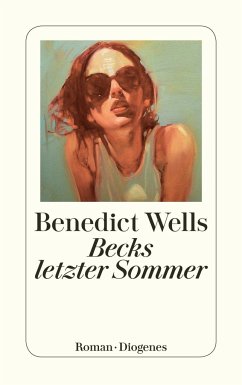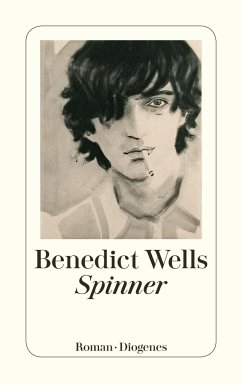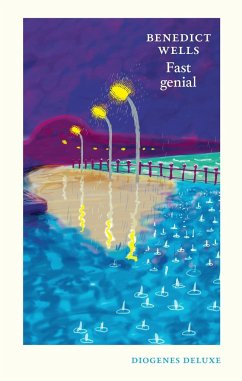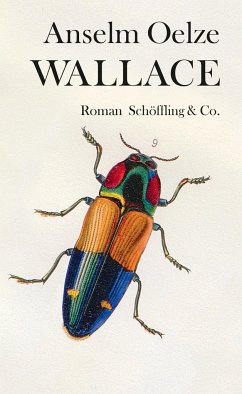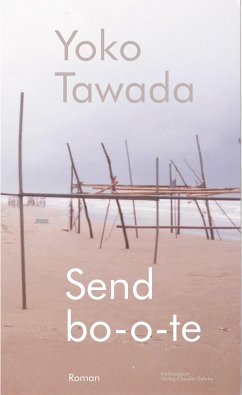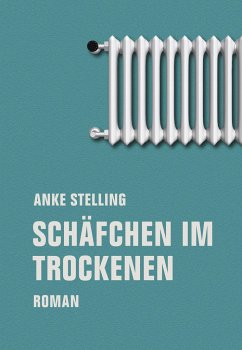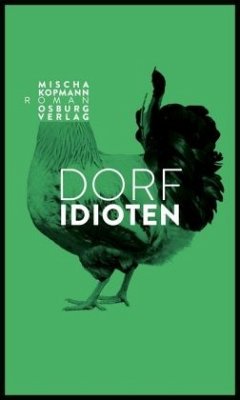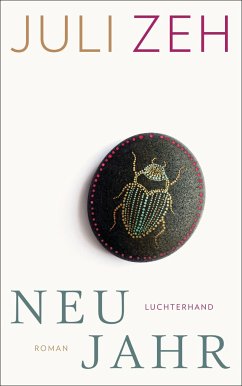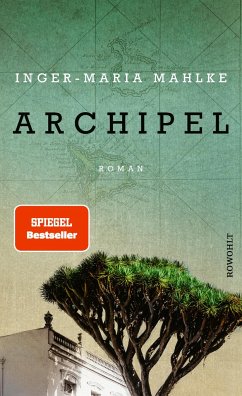Nicht lieferbar
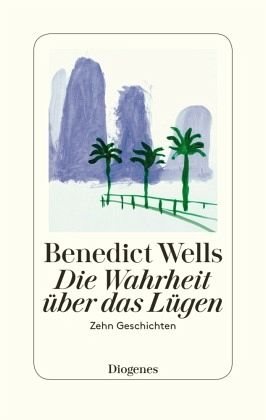
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:





Es geht um alles oder nichts in diesen Geschichten. Sie handeln vom Unglück, frei zu sein. Von einem Ort, an dem keiner freiwillig ist und der dennoch zur Heimat wird. Von einem erfolglosen Drehbuchautor der Gegenwart, der in das Hollywood des Jahres 1973 katapultiert wird, um die berühmteste Filmidee des 20. Jahrhunderts zu stehlen. Und nicht zuletzt eine Erzählung aus dem Universum des Romans 'Vom Ende der Einsamkeit', die Licht auf ein dunkles Familiengeheimnis wirft.
Benedict Wells wurde 1984 in München geboren, zog nach dem Abitur nach Berlin und entschied sich gegen ein Studium, um zu schreiben. Seinen Lebensunterhalt bestritt er mit diversen Nebenjobs. Sein vierter Roman, 'Vom Ende der Einsamkeit', stand mehr als anderthalb Jahre auf der Bestsellerliste, er wurde u.a. mit dem European Union Prize for Literature (EUPL) 2016 ausgezeichnet und ist bislang in 38 Sprachen erschienen. Nach Jahren in Barcelona lebt Benedict Wells in Zürich.
Produktdetails
- Verlag: Diogenes
- Seitenzahl: 256
- Erscheinungstermin: 23. August 2018
- Deutsch
- Abmessung: 189mm x 122mm x 18mm
- Gewicht: 289g
- ISBN-13: 9783257070309
- ISBN-10: 3257070306
- Artikelnr.: 52384040
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Oliver Jungen begreift nicht, warum diese Fingerübungen von Benedict Wells als Hardcover unters Volk müssen. Disparat und harmlos, sprachlich schülerhaft erzählt der Autor hier laut Rezensent klischeehaft von reuigen Managern, eifersüchtigen Büchern in einer Bibliothek und einer alternativen Filmgeschichte, in der eine Zeitmaschine eine tragende Rolle spielt. Klingt in seiner Kunstlosigkeit und symbolischen Bemühtheit für Jungen sehr nach Creative-writing-Kurs.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Ein Ausnahmetalent in der jungen deutschen Literatur.«
In zehn Geschichten erzählt Benedict Wells von den kleinen und großen Abgründen des Lebens, von Menschen mit all ihren Stärken und Schwächen, von Lüge und Wahrheit. Die Geschichten sind unterschiedlich lang, die Titelgeschichte ist mit Abstand die längste und …
Mehr
In zehn Geschichten erzählt Benedict Wells von den kleinen und großen Abgründen des Lebens, von Menschen mit all ihren Stärken und Schwächen, von Lüge und Wahrheit. Die Geschichten sind unterschiedlich lang, die Titelgeschichte ist mit Abstand die längste und setzt sich mit einer alternativen Realität auseinander, in der Zeitreisen möglich sind und ein junger Mann so das Leben von George Lucas, dem berühmten Erfinder der Star Wars Reihe, durcheinanderbringt. Eine witzige Idee, die wunderbar funktioniert, so wie Wells sie umsetzt.
Insgesamt sind alle Geschichten nicht nur sprachlich einfach großartig geschrieben, sie fließen dahin und ziehen einen als Leser schon von der ersten Zeile an mit. Auch die Situationen und Handlungsstränge, die der Autor beschreibt, sind mit so viel Kreativität und Witz umgesetzt, dass man als Leser einfach begeistert ist. Doch auch für die kleinen alltäglichen Situationen hat Wells einen ganz besonders Blick. Er schafft es, kleinen Momenten eine ganz große Bühne zu geben und auf den ersten Blick unscheinbaren Personen in den Fokus zu rücken, wie beispielsweise der immer zurücksteckenden Hausfrau in der Erzählung „Die Fliege“.
Ich bin von Benedict Wells Erzählband „Die Wahrheit über das Lügen“ einfach nur begeistert, selten haben mich in einem Sammelband wirklich alle Geschichten so direkt berührt wie in diesem Fall. Der Autor ist ist nicht nur ein großartiger Schriftsteller, er ist auch ein Beobachter und Menschenkenner, wenn er so viele verschiedene Figuren so auf den Punkt gebracht darstellen kann. Ein geniales Buch, das man immer wieder lesen muss, weil die Geschichten auf ihre Art so inspirierend sind.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für