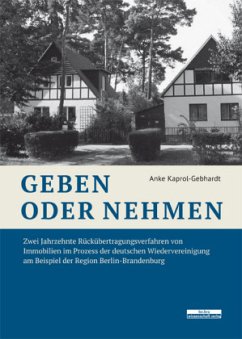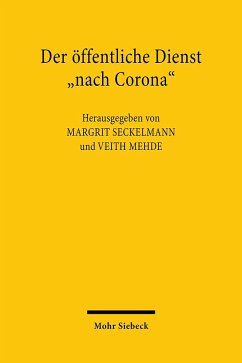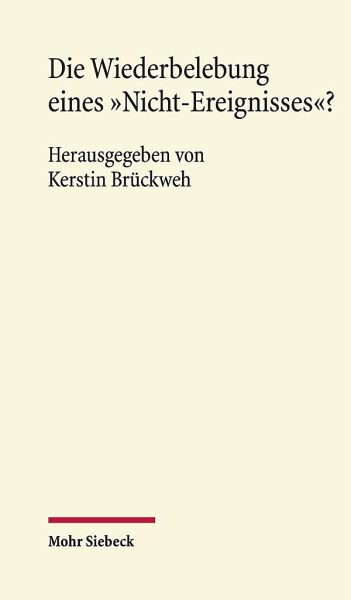
Die Wiederbelebung eines "Nicht-Ereignisses"?
Das Grundgesetz und die Verfassungsdebatten von 1989 bis 1994. Eine Veröffentlichung aus dem Arbeitskreis für Rechtswissenschaft und Zeitgeschichte an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz
Herausgegeben: Brückweh, Kerstin
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
39,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Wieso wurde in einem so zentralen Moment der deutschen Geschichte, wie der Vereinigung der beiden deutschen Teilstaaten 1990, das bundesdeutsche Grundgesetz nicht durch eine gesamtdeutsche Verfassung ersetzt? Zeigt sich darin das Desinteresse "der" Westdeutschen - wie neuerdings wieder vermutet wird? Welche anderen Gründe lassen sich für dieses "Nicht-Ereignis", wie es schon Mitte der 1990er genannt wurde, anführen? Diesen Fragen wird in den Beiträgen des Bandes aus ost- und westdeutscher sowie generationen- und disziplinenübergreifender Perspektive nachgegangen. Damit verbunden ist zudem...
Wieso wurde in einem so zentralen Moment der deutschen Geschichte, wie der Vereinigung der beiden deutschen Teilstaaten 1990, das bundesdeutsche Grundgesetz nicht durch eine gesamtdeutsche Verfassung ersetzt? Zeigt sich darin das Desinteresse "der" Westdeutschen - wie neuerdings wieder vermutet wird? Welche anderen Gründe lassen sich für dieses "Nicht-Ereignis", wie es schon Mitte der 1990er genannt wurde, anführen? Diesen Fragen wird in den Beiträgen des Bandes aus ost- und westdeutscher sowie generationen- und disziplinenübergreifender Perspektive nachgegangen. Damit verbunden ist zudem die Frage, welche Geschichten wir über unsere Verfassung erzählen und was sich daraus über die deutsche Geschichte ablesen lässt.