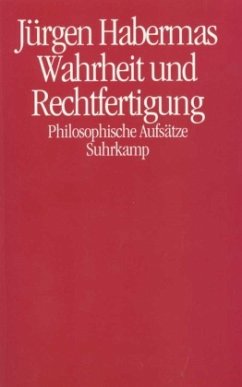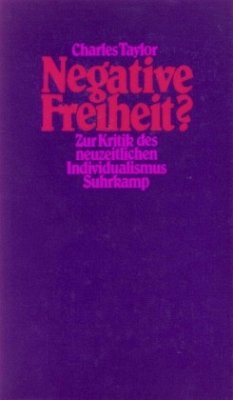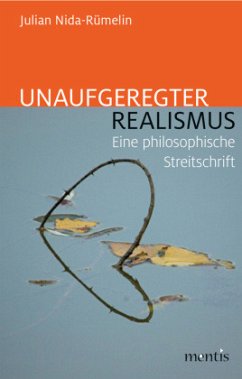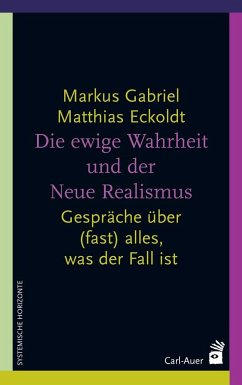Nicht lieferbar

Die Wiedergewinnung des Realismus
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Als René Descartes im 17. Jahrhundert die Erkenntnistheorie neu erfand, revolutionierte er mehr als eine philosophische Disziplin. Er begründete ein Denkschema, das das metaphysische und ethische Selbstverständnis der westlichen Moderne umfassend geprägt hat und uns - so Hubert Dreyfus und Charles Taylor - bis heute beherrscht. Da es aber auf falschen Voraussetzungen ruht, muss es final dekonstruiert werden. Dies ist das Ziel ihres Buches.Dazu gilt es, Descartes' wirkmächtigste Idee vom Tisch zu nehmen. Sie lautet, dass wir nie in direkten Kontakt mit der Außenwelt treten, sondern stets ...
Als René Descartes im 17. Jahrhundert die Erkenntnistheorie neu erfand, revolutionierte er mehr als eine philosophische Disziplin. Er begründete ein Denkschema, das das metaphysische und ethische Selbstverständnis der westlichen Moderne umfassend geprägt hat und uns - so Hubert Dreyfus und Charles Taylor - bis heute beherrscht. Da es aber auf falschen Voraussetzungen ruht, muss es final dekonstruiert werden. Dies ist das Ziel ihres Buches.Dazu gilt es, Descartes' wirkmächtigste Idee vom Tisch zu nehmen. Sie lautet, dass wir nie in direkten Kontakt mit der Außenwelt treten, sondern stets vermittelt durch Vorstellungen in unserem Geist. Dreyfus und Taylor zeigen, dass diese Idee bis in die Gegenwart überlebt hat, sogar bei den Philosophen, die behaupten, sie überwunden zu haben. Und sie entwickeln eine Alternative in Rückbesinnung auf eine Traditionslinie, die von Aristoteles bis zu Heidegger und Merleau-Ponty reicht.Anhand von Begriffen wie Dasein, Zeitlichkeit und Verkörperung skizzieren sie ein radikal neues Paradigma, das den Menschen als immer schon in direktem Kontakt mit der Welt begreift: einen robusten pluralen Realismus, der auch in ethisch-politischer Hinsicht einheitsstiftende Kraft hat. Es ist der endgültige Abschied von Descartes - souverän inszeniert von zwei der bedeutendsten Denker unserer Zeit.