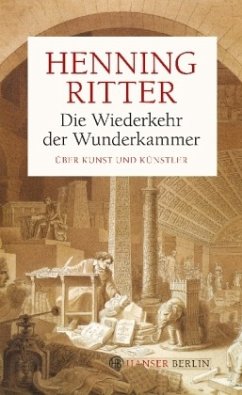Das Kunstmuseum, eine der erfolgreichsten Erfindungen der europäischen Kulturgeschichte, durchlief eine dramatische Entwicklung. An seinem Beginn stand die Auflösung der Wunderkammer fürstlicher Provenienz. Erst in der Zeit der Französischen Revolution, als Vandalismus die Kunst bedrohte und Napoleons Kunstraub Gemälde und Statuen aus ganz Europa nach Paris brachte, fand es im Louvre zu einer vorläufigen Form. Am Beispiel der Museumsinsel in Berlin zeigt Ritter schließlich die kontroverse Geschichte des Museumsgedankens selbst. So sollte ausgerechnet die Integration von Gegenwartskunst - in diesem Fall jener des späten 19. Jahrhunderts - dem Museum als Hort und Symbol der Vergangenheitsbewahrung neues Leben einhauchen.

Henning Ritters letztes Buch handelt vom Staunen, Schauen und anderen Abenteuern des Auges
Sehen, einfach sehen, ist alles in allem ziemlich schwer. Schwer ist es, weil das Sehen sich an das Sichtbare halten muss, wenn es ein einfaches Sehen sein will. Was sichtbar ist, ist aber seit immer schon von den Meinungen zugestellt, weil Meinungen prinzipiell blind sind. Sehen ist zuerst ein Meinungsvernichtungsakt. Ein Schritt aus der anfänglichen Blindheit, der wenig mit Aufklärung im engen Sinn zu tun hat, weil das, was man dann sieht, immer paradox, fragil und flüchtig ist.
Wenn das Sehen aber so schwer ist, heißt das nichts Gutes für den Beobachter. Zumal "der Mensch als Beobachter ein Spätentwickler ist", wie Henning Ritter in seinem gerade erschienenen Buch "Die Wiederkehr der Wunderkammer. Über Kunst und Künstler" schreibt. Sogar das Nächste, schreibt Ritter weiter, das pochende Herz, habe sich der Neugierde der Menschen lange entzogen. Erst im Jahr 1628 gelang dem britischen Anatomen William Harvey die Beschreibung des Blutkreislaufs. Vorausgegangen waren dieser Entdeckung lange Experimentreihen mit Mühlen und Pumpen.
Das geschah zu einer Zeit, als Galilei gerade mit dem Fernrohr zu den Sternen vorgestoßen war, Johannes Kepler die Planetentafeln neu berechnete und kühne Seefahrer auf den Weltmeeren nach neuen Passagen suchten. In einer Zeit also, als das Sehen alles andere als einfach war, weil es auf gerade gemachten technischen Entdeckungen basierte, die den Blick veränderten.
Die neuzeitlichen Beobachtungen basieren wesentlich auf der technischen Phantasie und den daraus resultierenden Entdeckungen. Aber dennoch wird erst im Moment der neuzeitlichen Technisierung des Blicks überhaupt der Weg zu einem einfachen Sehen freigelegt, das allen, jedem und jeder, jederzeit zugänglich und erreichbar ist. Auf diese paradoxe Wendung kann man die unausgesprochene These von Ritters Buch bringen.
Der Band versammelt Texte über Ausstellungen, Künstler und Kunsttheoretiker, die Henning Ritter, der im vergangenen Jahr gestorben ist, für diese Zeitung schrieb. Die nicht chronologische Abfolge der Texte und die Überschriften hatte Ritter noch selbst besorgt. Deshalb kann man auch die Überschriften des ersten und letzten Textes als Wegweiser durch seinen Gedankengang lesen. "Abenteuer des Auges unter der Milchstraße" heißt der erste, "Die Liebe der Massen zur Kunst" ist der letzte überschrieben.
Das Abenteuer des Auges findet Ritter in den Bildern des Malers Adam Elsheimer. Elsheimer, der 1610 im Alter von zweiunddreißig Jahren in Rom arm starb, hatte als Erster mit mehreren unabhängigen Lichtquellen gearbeitet, welche die Bildzonen seiner kleinformatigen, auf Kupfer gemalten Bilder ausleuchten und deutlich voneinander absetzen. Besonders in seinen Landschaftsdarstellungen und im ersten Sternenhimmel überhaupt, auf dem die Milchstraße zu sehen ist, werden die verschiedenen Lichtzentren zu einem "geheimnisvollen Naturtheater". Einem Theater, das Ritter auch in der Aktion von Christos Reichstagsverpackung wiederfindet, in der sich die Liebe der Massen zur Kunst eine bis dahin so nicht bekannte Bahn gebrochen hat.
Christos verhüllter Reichstag locke, meint Ritter, einen Kunstidealismus sehr früher Stufe hervor, nicht fern von dem der Jagdtiere von Lascaux. So wie die Maler von Lascaux vor zwanzigtausend Jahren die Tiere in ihrer vorbeiziehenden Flüchtigkeit gemalt haben, die es unmöglich macht, zu entscheiden, ob es sich um Kunst-, Natur- oder Traumeindrücke handelt, vermeidet auch Christos Aktion jede Festlegung. Christos Reichstag mache etwas präsent, von dem trotz einer keineswegs mystifikatorischen Konkretheit der Anschauung nicht leicht zu sagen sei, worum es sich handele. Hinzu komme bei Christo noch der temporäre, rein vorübergehende Charakter der Verhüllung. Das Werk verschwindet mit derselben Sicherheit, wie die Herden der Wildtiere im Jahreszyklus auch die Gegenden um Lascaux wieder verlassen haben zu ihrer Zeit. Beide Ereignisse verweisen für Ritter auf eine Utopie der Spurlosigkeit - sie gehen, wie sie gekommen sind, ohne dass man ihren Orten die kurzzeitige Anwesenheit noch ansehen könnte.
"Durch diesen utopischen Gehalt von Friedlichkeit und Folgenlosigkeit hat die Reichstagsverhüllung ihre politische wie ästhetische Strahlkraft gewonnen", heißt es im letzten Satz des Buches. Darin liegt aber viel mehr als nur ein abschließendes Urteil über Christos verhangenen Reichstag. Es ist auch der sozusagen offene Ausgang von Ritters eigener Kunsttheorie. Was einst gut versteckt vor den Versorgungen des Alltags bei Fackellicht in abgeschiedenen Höhlen begann, die teils nur über äußerste Anstrengungen zu erreichen waren, ist in der zugänglichsten Öffentlichkeit angekommen, die denkbar ist: auf einem öffentlichen Platz ohne Zugangsbeschränkungen. Nicht einmal mehr die Kunstkritik, die sich lange als Vermittler der modernen Kunst zum Publikum verstehen durfte, kann sich vor dem Reichstag noch vor das Gebanntsein von Tausenden durch die bloße Erscheinung stellen.
Die Automatismen, das Reflexhafte und die Primitivismen der modernen Kunst sind mit ihrem Glauben an den ungefährlichen guten Menschen dem uralten Stammespalaver ähnlicher geworden als einer Gruppe von Museumsbesuchern vor einem Gemälde von Jackson Pollock. Dieses Ähnlichwerden ist bei Ritter aber kein Rückschritt in vergangene historische Tiefen oder reaktionäre Gefühlslagen, es ist, im Gegenteil, der einzige Ausweg, der friedlich in die Zukunft weist. Und genau in diesem Sinn spricht Ritter auch von der Wiederkehr der Wunderkammer.
Es geht ihm nicht um die Wiederherstellung der alten Institution, sondern um eine Wiederholung der Bewegung des Sehens, wie sie in der alten Wunderkammer möglich geworden war. Die fürstlichen Wunderkammern versammelten alle möglichen antiken oder kuriosen Dinge: Münzen, Skulpturen, Instrumente, Versteinerungen, Tafeln, gepresste Pflanzen und ausgestopfte Tiere. Für Ritter entscheidend ist, dass in der Wunderkammer die Dinge der Kunst und der Natur nicht getrennt sind und dass sie nicht in chronologische Ordnung gebracht wurden. Es gab in ihnen noch keine Ordnung nach Erdzeitaltern oder Kunstepochen. Zudem waren sie der Öffentlichkeit verschlossen und nur Spezialisten oder Potentaten zugänglich.
Bedingungen, die sich ab der Mitte des 18. Jahrhunderts und vor allem mit der Französischen Revolution radikal ändern. Öffentlichkeit und die chronologische Präsentation der Exponate werden genauso verpflichtend wie die Trennung von Kunst und Natur. Mit der Öffnung des Louvre im Jahr 1793 als Kunstmuseum und der fast gleichzeitigen Umfunktionierung des Jardin des Plantes zum ersten öffentlichen Zoo als Bildungs- und Forschungsanstalt wird die Trennung institutionalisiert. Es beginnt eine große Zeit der Entwicklung kunsthistorischer und empirischer Naturwissenschaften. Die Kunst- und Museumsgeschichte hat Ritter am Beispiel der Berliner Museumsinsel in mehreren Texten im Buch untersucht.
Entscheidend für seinen Wunsch nach der Wiederkehr der Wunderkammer ist aber eine auf der Naturseite gemachte Beobachtung. Es sei eine der Paradoxien des Darwinismus, schreibt Ritter in seinen 2010 erschienenen "Notizheften", dass er die Einsamkeit des Menschen im Naturreich überwinden wollte, nachdem er den Menschen in das Ganze der Natur integriert hatte, diese Einsamkeit in Wahrheit aber noch verstärkt habe. Aus einem Grund, der mit dem Sehen zusammenhängt: "Der Blick in das Gesicht der schreckenerregenden Vettern erkennt nicht das Erschrecken in deren Blick", heißt es in einem seiner schönsten Sätze.
Die Beobachtung und damit das Sehen kranken bis heute daran, dass es nicht die Wirkung des Blicks im anderen Körper voraussetzt. Das Erschrecken im Blick des anderen Tieres zu erkennen, während man es anblickt, traute Ritter eher der Kunst und den neuen Bildwissenschaften zu als den sich vom Leben abwendenden, reduktionistischen Gen- und Neurotechnologien. In diesem Sinn kommen die Wunderkammern zurück: Kunst und Künstler wenden sich den von den Wissenschaften liegengelassenen Bildern der Natur zu, staunend wie die Maler von Lascaux - nur in aller Öffentlichkeit.
CORD RIECHELMANN
Henning Ritter: "Die Wiederkehr der Wunderkammer. Über Kunst und Künstler". Hanser Berlin, 256 Seiten, 19,90 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Das Buch selbst ist eine Kunstkammer, findet Thomas Steinfeld nach der Lektüre von Henning Ritters postum veröffentlichtem Band mit Essays (Zeitungstexte eigentlich) zur Museumsinsel, Adolph Menzel oder auch Goya. Kunstgeschichtlich nämlich, meint Steinfeld, wird der Autor nie, eher sieht ihn der Rezensent als Wanderer durch Kunstkabinette und Museen von Paris bis London, entlang der Wandlungen der Ausstellungspraxis und immer mit der lässigen Haltung eines Autors, der scheinbar bloß den Gedanken eines Anderen weiterführt oder auf neue Verhältnisse überträgt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Ein wunderbar flüssiger und schlüssiger Text, dessen Teile sich zwar wie Essays lesen lassen, aber erst im Zusammenhang die ganze Tiefe der Auseinandersetzung mit dem Stoff zu erkennen geben. (...) Als unermüdlichen Gesprächspartner und Anreger wird jeder seiner Freunde und Kollegen Henning Ritter im Gedächtnis behalten. Und als den großartigen Stilisten, als der er sich hier noch einmal erweist." Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine, 05.03.14
"Man steht staunend in Ritters Wunderkammer der Interpretationen." Ingo Arend, Deutschland Radio Kultur, 20.03.14
"Man steht staunend in Ritters Wunderkammer der Interpretationen." Ingo Arend, Deutschland Radio Kultur, 20.03.14