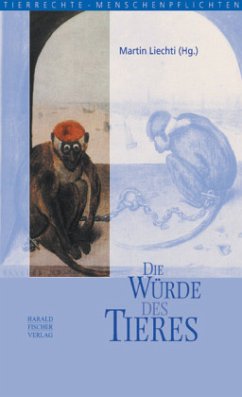Werden Menschen auf die Würde des Tieres angesprochen, so ist immer wieder festzustellen: Jede Einsicht wird sofort in ein gefühlsmäßiges Erleben projiziert, Denken und Fühlen sind hier eins.Tiere sind emotionsbesetzte Objekte, aber einen einwandfrei definierten Würdebegriff gibt es für sie nicht, und so ist es auch Ausdruck der emotionalen Beteiligung, daß heftig umstritten ist, was im Umgang mit ihnen erlaubt und was verboten ist.Das Symposium 'Die Würde des Tieres', das im März 2001 an der Universität Basel stattfand und aus dem der vorliegende Band hervorging, widmete sich seinem Thema von einem interdisziplinären Ansatz aus. Neben Beiträgen, die von einer philosophischen, anthropologischen oder psychologischen Perspektive ausgehen, stehen Beiträge, die sich rechtlichen und gesetzgeberischen Aspekten der Behandlung von Tieren widmen, die ganz praxisbezogen Fragen wie Tierversuche, Nutztierhaltung, Tierhaltung in Zoologischen Gärten, den Umgang mit Pferden oder Wildtieren - etwa bei der Walbeobachtung - oder auch den Einsatz von Tieren in der Werbung thematisieren.Dabei erweist sich immer wieder: So klar bei der Behandlung konkreter Fallbeispiele die Überzeugungen der Menschen sind, die in einer dem Alltagsverständnis gemäßen Achtung vor der Würde des Tieres ihren Niederschlag finden, so anspruchsvoll erweist sich die Aufgabe, die Tierwürde philosophisch zu begründen.Zur Klärung des Begriffs der Tierwürde wollen die insgesamt 25 Beiträge dieses Bandes auf verschiedenen Argumentationsebenen und aus verschiedenen Handlungs- und Forschungszusammenhängen heraus einen Beitrag leisten.Die Autorinnen und Autoren:Andrea Arz de Falco, Heike Baranzke, Andreas Brenner, Noëlle Delaquis, Ulrike Fiebrandt, Antoine F. Goetschel, Franz-Paul Gruber, Peter Krepper, Martin Liechti, Sigrid Lüber, Erhard Olbrich, Pat Parelli, Francine Patterson, Georg Pfleiderer, Klaus Peter Rippe, Alex Rübel, Horst Rumpf, Alexandra Schedel-Stupperich, Marianne Sommer, Andreas Steiger, Martin Walther, Steven Wise, Jean-Claude Wolf, Marlene Zähner, Jakob Zinsstag, Hansjörg Zürcher/Jürg Brechbühl.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Wie du mir, so ich dem Tier: Unseren Mitgeschöpfen "Würde" zusprechen zu wollen bleibt auch für Gutwillige ein haariges Unterfangen
Auf alten Karten findet sich für unerschlossene, noch nicht kartographierte Räume der Spruch "Hic sunt leones". Derartige Räume existieren nicht mehr; letztlich befindet sich heute jedes Tier in der Hand des Menschen. Vor allem diese Tatsache ist es, die den menschlichen Umgang mit Tieren zu einem normativ relevanten, mit den Mitteln der Ethik und des Rechts zu behandelnden Problem werden läßt. Ihm hat die Universität Basel im vergangenen Jahr eine Tagung gewidmet, deren Vorträge nunmehr in gedruckter Form vorliegen.
Tiere zivilisiert zu behandeln sollte für den Menschen bereits ein Gebot seiner Selbstachtung sein. Wie Jean-Claude Wolf zeigt, ist es nichts Geringeres als die Würde des Menschen selbst, die im Umgang mit Tieren auf dem Spiel steht. Menschen, die brutal oder gleichgültig das "Recht des Stärkeren" ausüben, schaden damit nicht nur dem betroffenen Tier; sie erleiden, wie Wolf in einer anrührend altmodischen Diktion bemerkt, auch "Schaden an ihrer eigenen Seele", sie brutalisieren sich selbst.
Dieser Gedanke ist freilich nicht neu. In ähnlicher Form findet er sich bereits bei Kant, und zwar in der wenig gelesenen "Tugendlehre" der "Metaphysik der Sitten". Heike Baranzke erinnert darin, daß nach Kant in Ansehung der Tiere Liebespflichten bestehen, die analog zu denjenigen sind, welche auch gegenüber Menschen existieren. Liebespflichten im kantischen Sinne haben nämlich die "Förderung fremder Glückseligkeit" zum Inhalt, und auch Tiere sind zu einer gewissen "Glückseligkeit" fähig. "Würde" im Sinne eines absoluten inneren Wertes, der "allen andern vernünftigen Weltwesen Achtung für ihn abnötigt", kommt nach Kant allerdings nur dem Menschen zu. Die damit für den Menschen in Anspruch genommene Vorzugsstellung zieht die Baseler Tagung bereits in ihrem Titel in Zweifel. Eine kürzlich in die schweizerische Bundesverfassung eingefügte Formulierung aufgreifend, fragt sie nach der "Würde des Tieres". Was ist damit gemeint?
Die Tiere seien in ihrer Selbstzweckhaftigkeit zu schützen, so lautet die Antwort einer Reihe von Referenten. Als Selbstzweck behandelt zu werden sei geradezu der Inbegriff dessen, was der Mensch kraft seiner Würde verlangen könne; dies dürfe deshalb auch dem Tier nicht vorenthalten werden. Unsere soziale Praxis spricht jedoch eine ganz andere Sprache. Dabei geht es keineswegs nur um notorisch problematische Felder wie Tierversuche und Genmanipulation. Die Dementierung des Ideals durch die Praxis setzt schon auf einer viel alltäglicheren Ebene ein, oder kann man ernsthaft behaupten, daß Tiere, die geschlachtet werden, um dem Menschen zur Nahrung zu dienen, als Zwecke an sich selbst behandelt würden? Man mag dieses Tun für insgesamt illegitim und barbarisch halten. Dann muß man dies aber auch deutlich aussprechen. Davor aber schrecken die Referenten zurück. Sie nutzen den rhetorischen Effekt des von ihnen beschworenen Prinzips aus, unterschlagen aber die Härte von dessen Konsequenzen. Indem sie zuviel beweisen, beweisen sie bei Licht besehen nichts.
Die unreflektierte Übertragung normativer Figuren aus dem menschlichen in den tierischen Bereich macht sich auch in anderen Beiträgen des vorliegenden Bandes störend bemerkbar. So formuliert Francine Patterson nach allen Regeln der politischen Korrektheit: "Jeder Hund, jedes Nashorn, jeder Skarabäus kann zum Mitbürger oder zur Mitbürgerin eines jeden Mannes, einer jeden Frau, eines jeden Kindes werden." Nun gut - aber Bürger zu sein heißt nicht nur, Inhaber von Rechten, sondern auch Träger von Pflichten zu sein. Sollen wir also Besserungsanstalten für Nashörner einrichten, die einen ihrer Mitbürger vom Stamme der Menschen niedergetrampelt haben? Sollen wir in Zukunft das tödliche Spiel der Katze mit der Maus unter den Tatbestand des grausamen Mordes subsumieren? Natürlich nicht - aber dann sollten wir auch zugestehen, daß die Rede von der Selbstzweckhaftigkeit des Tieres oder gar von dessen Bürgerstatus in der Gemeinschaft aller Lebewesen Assoziationen weckt, die sich argumentativ nicht überzeugend einlösen lassen.
Einige der Baseler Referenten erkennen dieses Problem. Um dem Begriff der Tierwürde trotzdem eine operablen Inhalt zu geben, bemühen sie sich um Ausweichstrategien. So plädiert Andreas Brenner für eine rangmäßige Abstufung von Würde, und Andrea Arz de Falca schlägt vor, zwischen absoluter und relativer Würde zu unterscheiden. In ihren Worten verlangt die Würde des Tieres lediglich "nach guten Gründen, wenn Tiere als Objekte menschlicher Nutzungsinteressen eingesetzt werden". Das Tier wird hier zum Gegenstand einer Interessenabwägung gemacht, es wird - um einen juristischen Terminus aufzugreifen - als "Gut" behandelt. Der Realismus eines solchen Ansatzes läßt sich nicht bezweifeln; höchst anfechtbar ist es aber, ihn als Explikation des Würdebegriffs auszugeben. Güter mögen als mehr oder weniger wertvoll angesehen werden; aber bereits die Möglichkeit als solche, sie vergleichend zu bewerten, stellt nach Kant den Beweis dafür dar, daß ihnen lediglich ein Preis und gerade keine Würde zukommt.
So dekonstruieren die Beiträge zur Würde des Tieres ihren eigenen Gegenstand. Weil dies gegen den Willen der Beitragenden geschieht, dürfte es freilich angemessener sein, schlicht vom Scheitern des Projekts zu sprechen, dem Begriff der Tierwürde einen akzeptablen Sinn zu geben. Dieses Scheitern hat exemplarischen Charakter. Es demonstriert ad oculos, daß die Weigerung, den Anwendungsbereich eines normativen Begriffs in sinnvoller Weise zu begrenzen, zu einer Überlastung des betreffenden Begriffs führt. Soll er sodann wieder an die soziale Realität herangeführt werden, muß dafür der Preis einer Erosion seines Bedeutungsgehalts gezahlt werden. Nicht selten wird dabei auch der ursprüngliche Begriffskern in Mitleidenschaft gezogen.
Das Schicksal des Würdebegriffs zeigt, daß die Folgen schwerwiegend sein können. Wird die Würde partiell auf den Status eines bloßen Gutes, das heißt eines Abwägungspostens reduziert, so verliert sie ihre Eindeutigkeit als Bezeichnung des Nicht-Abwägbaren. Unter den vielen Wegen, Gewalt semantisch zu verharmlosen, ist die stillschweigende Entkernung traditioneller normativer Begriffe einer der subtilsten und wirkungsvollsten. Weil die Gefahr, die von diesem Verfahren ausgeht, nicht nur die Tiere, sondern längst auch die Menschen betrifft, erscheint das vorliegende Buch zur rechten Zeit. Freilich muß man es rigoros gegen den Strich lesen: Als Anregung an die praktische Philosophie, ihre Aufmerksamkeit statt auf die laufende Erweiterung von Inklusionen wieder stärker auf die Begründung der feinen Unterschiede zu richten. MICHAEL PAWLIK.
Martin Liechti (Hrsg.): "Die Würde des Tieres". Harald Fischer Verlag, Erlangen 2002. 378 S., br., 27,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Wo ist die Grenze zwischen Mensch und Tier? Als Rousseau mit seinen Betrachtungen über den Naturzustand des Menschen für Aufsehen sorgte, fragte Voltaire zynisch, ob man nun auf allen Vieren laufen solle. Nachdem Michael Pawlik "Die Würde des Tieres" gelesen hatte, schüttelte er einen ähnlich spitzen Sarkasmus aus seinem Ärmel, allerdings genau andersrum, sozusagen den umgedrehten Voltaire: "Sollen wir also Besserungsanstalten für Nashörner einrichten, die einen ihrer Mitbürger vom Stamme der Menschen niedergetrampelt haben?" Das Buch ist aus einer Reihe von Vorträgen an der Universität Basel hervorgegangen. Teilweise, so Pawlik, sind philosophisch anspruchsvolle und lesenswerte Texte dabei, teilweise kippen die Beiträge aber ins Absurde und weichen die Grenze zwischen Mensch und Tier auf, ohne jedoch die "Härte" der Konsequenzen zu benennen - etwa ein generelles Schlachtverbot. Am Ende versöhnt sich Pawlik jedoch mit dem Buch, das mit seinen kontroversen Ansätzen sogar genau zum richtigen Zeitpunkt komme. "Freilich muss man es rigoros gegen den Strich lesen: Als Anregung an die praktische Philosophie, ihre Aufmerksamkeit statt auf die laufenden Erweiterung von Inklusion wieder stärker auf die Begründung der feinen Unterschiede zu richten."
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH