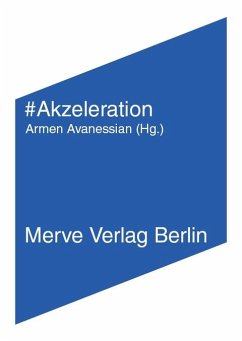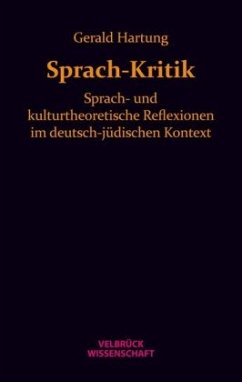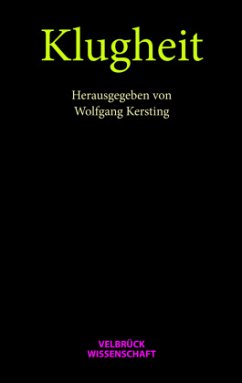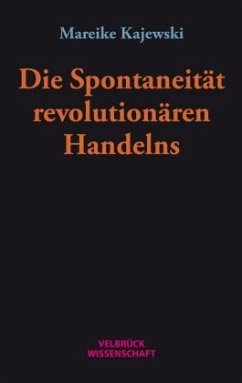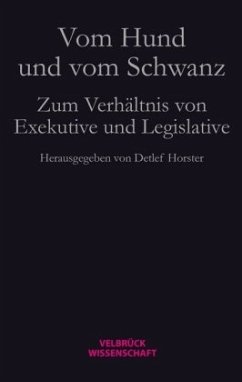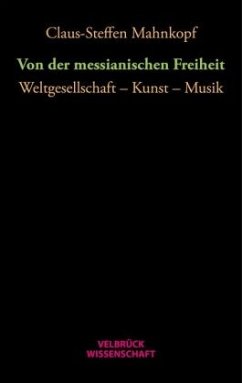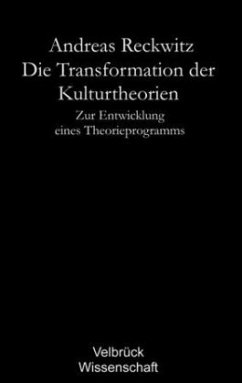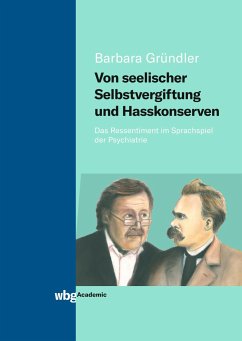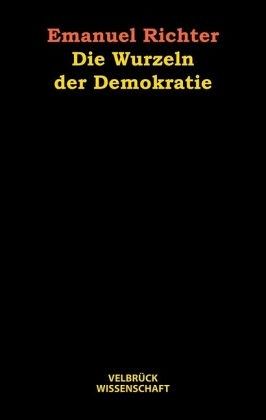
Die Wurzeln der Demokratie
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
39,90 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Das Buch dient dem Nachweis, dass die Demokratie die einzige politische Organisationsform darstellt, die dem grundlegenden menschlichen Selbstverständnis entspricht. Demokratie liefert den politischen Ausdruck für die Unausweichlichkeit von sozialer Interaktion, sie ist in der sozialen Existenzform des Menschen verwurzelt. Sie stellt das Pendant dar zu unserem menschlichen Selbstverständnis als soziale, auf Interaktion angewiesene Lebewesen, das immer neuer Stufen der authentischen Verwirklichung bedarf. So, wie jedem Menschen die gleiche Anerkennung und die Möglichkeit zu intensiver Inter...
Das Buch dient dem Nachweis, dass die Demokratie die einzige politische Organisationsform darstellt, die dem grundlegenden menschlichen Selbstverständnis entspricht. Demokratie liefert den politischen Ausdruck für die Unausweichlichkeit von sozialer Interaktion, sie ist in der sozialen Existenzform des Menschen verwurzelt. Sie stellt das Pendant dar zu unserem menschlichen Selbstverständnis als soziale, auf Interaktion angewiesene Lebewesen, das immer neuer Stufen der authentischen Verwirklichung bedarf. So, wie jedem Menschen die gleiche Anerkennung und die Möglichkeit zu intensiver Interaktion zukommen sollten, ist die Demokratie als egalitäre und partizipative Interaktion auszurichten. Eine »Stimme« in der Demokratie zu besitzen heißt nicht nur, ein »Votum« zu haben, sondern viel umfassender ausgiebig »zu Wort zu kommen«. Die Demokratie zielt auf paritätische Begegnung, auf Interaktion unter Gleichen, auf größtmöglichen gegenseitigen Austausch. Sie ruft beständig nach neuen Formen ihrer Verwirklichung, die unter wechselnden zeitlichen und räumlichen Rahmenbedingungen die Nähe zwischen der Politik und den Grundmechanismen der sozialen Interaktion herstellen. Jacques Derrida hatte dafür das treffende Bild von der »démocratie à venir« geprägt.Insofern bleiben zunächst die Wurzeln der Demokratie in den Prinzipien sozialer Integration zu veranschaulichen. Danach werden die idealen Formen einer solchen partizipativen Demokratie erläutert. Schließlich können die Folgen dieser partizipatorischen Demokratie an exemplarischen politischen Problemfeldern der Gegenwart veranschaulicht werden.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.