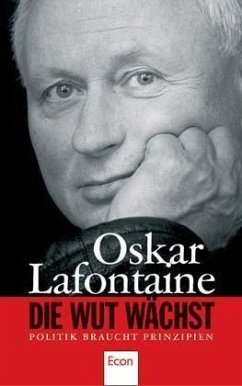Kriegseinsätze, kein Wirtschaftswachstum, immer mehr Arbeitslose, Steueroasen für die Reichen und Lohndrückerei - es ist genug. Oskar Lafontaine nimmt die Unterlassungssünden der Rot-Grün-Regierung scharf ins Visier. Der Ex-SPD-Chef geißelt die Außenpolitik seit dem Kosovo- und jetzt dem Afghanistan-Einsatz und kritisiert die "neue Mitte": sie hat es versäumt, zusammen mit den Globalisierungskritikern eine neue Vision für die Linke zu entwerfen. Eine bessere Welt kann nicht auf den Interessen der Stärkeren aufgebaut werden, sondern braucht eine Weltinnenpolitik, die den Mächtigen auch wirtschaftlich Grenzen setzt.
Wut - Die Fortsetzung
Nachdem Oskar Lafontaine nach nur 136 Tagen die rot-grüne Koalition verlassen und alle politischen Ämter niedergelegt hatte, war es still um ihn geworden. Aufsehen erregte seine Abrechnung Das Herz schlägt links, die von vielen ehemaligen Parteifreunden als ungerechter Angriff empfunden wurde. Die Wut wächst kann nun als Fortsetzung dieser Abrechnung gelesen werden. Er zieht darin eine ernüchternde Bilanz nach fast vier Jahren rot-grüner Regierung. Einer seiner zentralen Kritikpunkte ist die Orientierung der Sozialdemokratie an der so genannten Neuen Mitte, die einherging mit der Suche nach besonders mehrheitsfähigen, um nicht zu sagen populistischen Positionen, die nicht Ausdruck einer genuin politischen Weltsicht sind, sondern einem - vorwiegend ökonomisch begründeten - Pragmatismus entspringen. Es bedürfe aber, so formuliert Lafontaine mit Gandhi, einer Politik mit Prinzipien. Daher fühlt er sich Willy Brandt und dessen Politik der Entspannung verbunden. In diesem Geiste kritisiert er als weiteren faulen Kompromiss der Schröder-Regierung deren Kosovo-Politik, die er als Abkehr von jeder friedlichen Konfliktlösung anklagt.
Globalisierung als Chance
Vor dem Hintergrund der allgegenwärtigen Diskussion um die Globalisierung rät Oskar Lafontaine, heute skeptischer als noch in seinem Band Keine Angst vor der Globalisierung (1998), innezuhalten und drastisch umzudenken. Wie die Globalisierungskritiker von "attac" so fordert auch er ganz neue Ansätze: Dies betrifft die Rolle der UNO als Weltpolizei, die Entschuldung der armen Länder, das Austrocknen von Steueroasen, die Einführung der Tobin-Steuer oder eine "Weltfinanz-Architektur". Letztlich geht es Lafontaine bei allen Exkursen um eines der ältesten Themen der deutschen Sozialdemokratie: die soziale Gerechtigkeit. Wie lässt sich soziale Gerechtigkeit verwirklichen, und zwar nicht nur für Deutschland, sondern weltweit? Die Sozialdemokratie sieht er dabei als potenziellen Motor, denn: "Wer den Linken das Totenglöckchen läutet, hat die Signale von Seattle bis Genua nicht verstanden." Die Themen liegen sozusagen auf der Straße, allein: Die Genossen machen nichts daraus.
Eine wichtige Stimme
Hier schreibt jemand, der wirklich etwas zu sagen hat und sich nicht wie viele Kollegen hinter "politischen Sachzwängen" verschanzt. Oskar Lafontaine legt eine pointierte Analyse aktueller Probleme vor, die sich allerdings auch den Vorwurf gefallen lassen muss, einem - wenn auch gezähmten - Etatismus verpflichtet zu sein, dem heute nur noch wenige folgen wollen.
(Henrik Flor, literaturtest.de)
Nachdem Oskar Lafontaine nach nur 136 Tagen die rot-grüne Koalition verlassen und alle politischen Ämter niedergelegt hatte, war es still um ihn geworden. Aufsehen erregte seine Abrechnung Das Herz schlägt links, die von vielen ehemaligen Parteifreunden als ungerechter Angriff empfunden wurde. Die Wut wächst kann nun als Fortsetzung dieser Abrechnung gelesen werden. Er zieht darin eine ernüchternde Bilanz nach fast vier Jahren rot-grüner Regierung. Einer seiner zentralen Kritikpunkte ist die Orientierung der Sozialdemokratie an der so genannten Neuen Mitte, die einherging mit der Suche nach besonders mehrheitsfähigen, um nicht zu sagen populistischen Positionen, die nicht Ausdruck einer genuin politischen Weltsicht sind, sondern einem - vorwiegend ökonomisch begründeten - Pragmatismus entspringen. Es bedürfe aber, so formuliert Lafontaine mit Gandhi, einer Politik mit Prinzipien. Daher fühlt er sich Willy Brandt und dessen Politik der Entspannung verbunden. In diesem Geiste kritisiert er als weiteren faulen Kompromiss der Schröder-Regierung deren Kosovo-Politik, die er als Abkehr von jeder friedlichen Konfliktlösung anklagt.
Globalisierung als Chance
Vor dem Hintergrund der allgegenwärtigen Diskussion um die Globalisierung rät Oskar Lafontaine, heute skeptischer als noch in seinem Band Keine Angst vor der Globalisierung (1998), innezuhalten und drastisch umzudenken. Wie die Globalisierungskritiker von "attac" so fordert auch er ganz neue Ansätze: Dies betrifft die Rolle der UNO als Weltpolizei, die Entschuldung der armen Länder, das Austrocknen von Steueroasen, die Einführung der Tobin-Steuer oder eine "Weltfinanz-Architektur". Letztlich geht es Lafontaine bei allen Exkursen um eines der ältesten Themen der deutschen Sozialdemokratie: die soziale Gerechtigkeit. Wie lässt sich soziale Gerechtigkeit verwirklichen, und zwar nicht nur für Deutschland, sondern weltweit? Die Sozialdemokratie sieht er dabei als potenziellen Motor, denn: "Wer den Linken das Totenglöckchen läutet, hat die Signale von Seattle bis Genua nicht verstanden." Die Themen liegen sozusagen auf der Straße, allein: Die Genossen machen nichts daraus.
Eine wichtige Stimme
Hier schreibt jemand, der wirklich etwas zu sagen hat und sich nicht wie viele Kollegen hinter "politischen Sachzwängen" verschanzt. Oskar Lafontaine legt eine pointierte Analyse aktueller Probleme vor, die sich allerdings auch den Vorwurf gefallen lassen muss, einem - wenn auch gezähmten - Etatismus verpflichtet zu sein, dem heute nur noch wenige folgen wollen.
(Henrik Flor, literaturtest.de)
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Dass der Titel dieses Buches ans Herz geht, findet die Rezensentin Cathrin Kahlweit schon, doch gerade darin liegt für sie das Problem. Lafontaine beschäftigt sich mit der "Weltinnenpolitik", doch kommt er in seiner Aufbereitung der weltgeschichtlichen Ereignisse der letzten Jahre immer zum selben Ergebnis, bemängelt Kahlweit. Lafontaines These: Die Machtfülle der USA verschiebe die weltpolitischen Kräfteverhältnisse und müsse daher einer internationalen Kontrolle, etwa der UNO unterstehen. Das Stichwort, so die Rezensentin, sei hier allerdings nicht Anti-Amerikanismus, wohl aber Globalisierungsgegnerschaft. Doch Kahlweit ist von den "simplen Analysen und Antworten" eher befremdet und nennt Lafontaines Buch "erschreckend naiv und populistisch", eine "Landeskunde für Klippschüler". Und sollte Lafontaine vorgehabt haben, sich mit diesem Buch um das Amt des Außenministers zu bewerben, so Kahlweit, dann stehen die Chancen schlecht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH