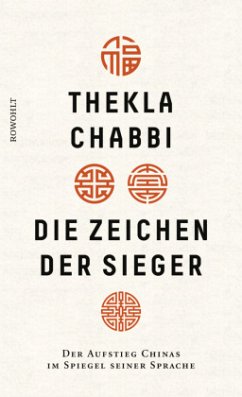Was die meistgesprochene Sprache der Welt über Chinas Aufstieg zur Großmacht verrät
«Inzwischen haben sich die Verhältnisse gewandelt. Heute spielt China weltpolitisch eine gewichtige Rolle, die es sich nicht mehr streitig machen lässt. Diese Entwicklung wäre ohne die grenzenlose, aus der konfuzianischen Tradition hervorgegangene Lern- und Bildungsbereitschaft der Chinesen nicht möglich gewesen. Heute reicht es nicht mehr, China auf der Oberfläche zu begegnen, es wie früher zu missionieren, zu erobern oder als reinen Wirtschaftsstandort zu betrachten und ansonsten verächtlich auf die Nation herabzublicken. Denn die Volksrepublik braucht den Westen nicht mehr, als der Westen China braucht. Heute bedarf es einer Verständigung in Kenntnis der Erfahrungen, die unformuliert im Hintergrund wirken.»
«Inzwischen haben sich die Verhältnisse gewandelt. Heute spielt China weltpolitisch eine gewichtige Rolle, die es sich nicht mehr streitig machen lässt. Diese Entwicklung wäre ohne die grenzenlose, aus der konfuzianischen Tradition hervorgegangene Lern- und Bildungsbereitschaft der Chinesen nicht möglich gewesen. Heute reicht es nicht mehr, China auf der Oberfläche zu begegnen, es wie früher zu missionieren, zu erobern oder als reinen Wirtschaftsstandort zu betrachten und ansonsten verächtlich auf die Nation herabzublicken. Denn die Volksrepublik braucht den Westen nicht mehr, als der Westen China braucht. Heute bedarf es einer Verständigung in Kenntnis der Erfahrungen, die unformuliert im Hintergrund wirken.»

Wo die Partei verfügt, welche Begriffe die Bürger nicht verwenden sollten: Thekla Chabbi wählt den Zugang über die Sprache, um Züge der von Tradition tief geprägten chinesischen Kultur zu erläutern.
Eigentlich müssten heute Millionen von Nichtchinesen auf der ganzen Welt Chinesisch lernen, ist es doch die Sprache der neuen Weltmacht China oder - mit den Worten von Thekla Chabbi - die Sprache der "Sieger". Gerade dieses Etikett mag allerdings nicht so recht passen. Eine selbstbewusste Siegermacht würde nicht Uiguren in Umerziehungslagern verschwinden lassen und Hongkongs Jugend damit drohen, ihre Proteste mit Waffengewalt zu unterdrücken.
Chabbi geht es freilich nicht um Sprachenrivalität und die Kraftentfaltung des autoritären Regimes in Beijing. Sie lädt zu einer Begegnung mit der chinesischen Kultur über deren Sprache ein. Die Sinologin und Übersetzerin, die sich vor allem für Li Er einsetzt, einen der wichtigsten Autoren im gegenwärtigen China, führt eindrücklich in den Klang der chinesischen Sprache ein, in die innere Logik ihrer Schriftzeichen und deren Ordnung in größeren Zusammenhängen.
Da Sprache immer auch Bilder erzeugt sowie Werte und Traditionen vermittelt, lässt sich über sie mancher Aspekt der Geschichte eines Landes verstehen. China verfügt über die längste ununterbrochene Schrifttradition der Welt, die aber weder statisch war noch, wie im Westen lange vermutet wurde, zur Erstarrung der gesellschaftlichen Verhältnisse beitrug. So war der politische Systemwandel von 1911/12, als das mehr als zwei Jahrtausende alte Kaiserreich in eine Republik überging, von tiefgreifenden Veränderungen im Chinesischen begleitet. Sprache und Schrift wurden während der frühen Republikzeit vereinfacht, um die traditionelle Bildungselite stärker mit der bildungsferneren Bevölkerung zu verbinden, auch wenn man mit Thekla Chabbi darüber streiten könnte, ob dies wirklich bereits eine "Massenkulturbewegung" war.
Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts beschränkten sich Reforminitiativen und Proteste noch auf Erziehungsinstitutionen, die literarische Öffentlichkeit und die städtischen Mittelschichten. Sofern die Regierungen stark genug waren, betrieben sie Sprachpolitik. Bis zum heutigen Tag dient Sprache in China als Instrument der Herrschenden, die über die Grenzen des Sagbaren und die Zulässigkeit des Gesagten und Geschriebenen wachen.
Thekla Chabbi gelingt es, mit vielfältigen Einblicken in Schriftgebrauch und Sprachpraxis die Erfahrungszusammenhänge der Chinesen, aber auch ihren Umgang mit fremden Kulturen begreifbar zu machen. So schuf die Einführung der "Kleinen Siegelschrift" durch den ersten chinesischen Kaiser im dritten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung eine gemeinsame Schriftform für alle Regionalsprachen des neugegründeten Reiches. Zugleich grenzte sie die Teilnehmer an dieser Kommunikationsgemeinschaft von allen Völkern ab, die sich nicht mit der chinesischen Schrift vertraut machten; aus sinozentrischer Sicht blieben sie deshalb "Barbaren". Die Festlegung einer im ganzen Land gesprochenen oder zumindest verständlichen (Hoch-)Sprache ließ mehr als zwei Jahrtausende auf sich warten. Sie war erst das Werk der 1932 gegründeten Staatlichen Kommission zur Vereinheitlichung der Aussprache.
Die moderne politische Terminologie in China, ansonsten stark vom Westen geprägt, greift vielfach auf die Semantik des Altertums zurück. So spiegelt sich im chinesischen Begriff gonghe ("gemeinsame Harmonie") im Namen der 1912 ins Leben gerufenen "Republik" das ungebrochene Vertrauen ihres Gründervaters Sun Yatsen in die Symbolkraft alter Traditionen. Er berief sich auf die "gemeinsame Harmonie", von der im zweiten vorchristlichen Jahrhundert gesprochen wurde, als die Regierungsgeschäfte während einer herrscherlosen Periode erfolgreich von zwei reibungslos kooperierenden Kanzlern geführt wurden.
Anschaulich beschreibt Chabbi die sprachlichen Besonderheiten des Chinesischen, vor allem den für Ausländer nicht ohne Weiteres beherrschbaren Klang. Die chinesische Sprache verfügt nur über 418 Silben, die zur Aussprache einer viel größeren Zahl von Schriftzeichen verwendet werden. So enthält eines der wichtigsten klassischen Nachschlagewerke, das Cihai ("Zeichenmeer"), mehr als 85 500 unterschiedliche Schriftzeichen. Obwohl nur ein Bruchteil davon in ständigem Gebrauch ist, ergeben sich viele gleichlautende Zeichen und Wörter, zwischen deren Aussprache nur durch Veränderung der Tonalität differenziert werden kann. Die vier verschiedenen Töne der chinesischen Hochsprache haben bedeutungsunterscheidende Wirkung und müssen deshalb korrekt artikuliert werden. Kein Wunder, dass es Ausländern oftmals nicht gelingt, den richtigen Ton zu treffen. Hinzu kommt erschwerend das feine Gespür der Chinesen für Sprachrhythmus und Satzmelodie.
Eine gewisse Stütze bietet die phonetische Umschrift Pinyin, die 1958 nach langen Debatten über alternative Latinisierungssysteme in der Volksrepublik China amtlich eingeführt wurde, allerdings ohne die Absicht, die Zeichenschrift zu ersetzen. Viele Chinesisch-Kurse im Ausland beginnen mit Pinyin-Übungen, bevor sie in die Systematik der Schriftzeichen einführen. Allerdings sind es nur die Schriftzeichen selbst, die wichtige Erkenntnisse über Kultur, Gesellschaft und Politik liefern, beginnend mit den ältesten der bisher bekannten Schriftzeichen, die vor etwa hundertzwanzig Jahren auf neolithischen Tongefäßen entdeckt wurden. Inschriften auf Knochenfunden aus Orakelbefragungen bieten wichtige Informationen über die früheste historisch fassbare Dynastie Chinas, die Shang (sechzehntes bis elftes Jahrhundert vor Christus).
Bis zum heutigen Tag erfreut sich die chinesische Kunst der Kalligraphie weltweit hoher Wertschätzung. Die Erläuterungen Chabbis helfen, sich mit der Praxis des Schreibens vertraut zu machen. Unzähligen Generationen kulturell ehrgeiziger Chinesen dienten die Schriftzeichen als Zugang zu dem gewaltigen Lernpensum, das ihnen die konfuzianische Bildungstradition auferlegte. Doch erst die Einführung von etwa 2500 vereinfachten Kurzzeichen ermöglichte ab 1956 einen Alphabetisierungsschub quer durch die Bevölkerung. Diese Kurzzeichen haben sich in der Volksrepublik seit langem durchgesetzt, so dass die altchinesischen Klassiker heute vielfach in simplifizierter grafischer Gestalt - und überhaupt in modernisierenden "Übersetzungen" - gelesen werden. In Taiwan hält man aus (kultur-)politischen Gründen weiterhin an den komplizierteren Langzeichen fest. Schreibung und Aussprache sind in der Volksrepublik vereinheitlicht und genormt, nicht zuletzt durch die nationalen Medien. Während das in der Öffentlichkeit dominierende Hochchinesisch die nationale Einheit Chinas repräsentiert, erlauben die weiter geduldeten Dialektvariationen den Ausdruck patriotischer Gefühle für die eigene Heimatregion.
Eine weitere Besonderheit des Chinesischen verlangt ein Umdenken, wenn man sich ihm von europäischen Sprachen her nähert: Chinesische Wörter enthalten in der Regel keine sichtbaren grammatischen Informationen. Die Aussage eines Satzes ergibt sich aus der Anordnung seiner Wörter. Alle grammatischen Signale gehen von der Sequenz der Satzelemente aus. Trotz der oberflächlichen Einfachheit solcher Formenarmut weist die chinesische Sprache erhebliche Potentiale auf. Zum Beispiel erlaubt sie eine differenziertere Darstellung von Zeitlichkeit als die europäischen Sprachen. Dabei bedient sie sich eines Reichtums an Zeitwörtern, Adverbien und Partikeln.
Immer wieder kommt das Buch auf die Bedeutung von Sprache als Machtinstrument zurück. Im Zeitalter der Digitalisierung dringen Chinas Zensurbehörden tiefer als andere Staatsapparate in die Kommunikationswelt privater Computer ein. Die Kraft der Sprache wussten indes auch frühere Machthaber und kulturelle Eliten zu nutzen: die konfuzianischen Denker der Vormoderne ebenso wie ihre Gegner, die antikonfuzianischen Aktivisten der Vierten-Mai-Bewegung von 1919. Mit der Verankerung des "Gedankenguts" von Staatspräsident Xi Jinping als Leitlinie der Verfassung auf dem 19. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas im Jahre 2017 erreichte die Instrumentalisierung der Sprache einen neuen Höhepunkt. Bereits ein Jahr nach seinem Machtantritt hatte Xi 2013 sieben Redetabus (wörtlich: "sieben falsche Trends") proklamiert. Allein dass sie in westlichem Denken wurzeln, macht Begriffe wie "Konstitutionalismus", "Demokratie", "universale Werte", "Zivilgesellschaft" oder "Neoliberalismus" zu subversiven Reizvokabeln.
Was wie ein hilfloser Defensivreflex aussehen mag, kann leicht ins Offensive gewendet werden. Die mancherorts wachsende Einflussnahme von Konfuzius-Instituten auf das akademische Leben im Gastland lässt eine Verhärtung freundlicher "soft power" befürchten. Chinas Sprache wird zum wichtigen Bestandteil des neuen Weltmachtstrebens. Dennoch Chinesisch lernen? Vielleicht jetzt erst recht. Und nicht nur aus politischen Gründen.
SABINE DABRINGHAUS
Thekla Chabbi: "Die Zeichen der Sieger". Der Aufstieg Chinas im Spiegel seiner Sprache.
Rowohlt Verlag, Hamburg 2019. 190 S., geb., 25,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main