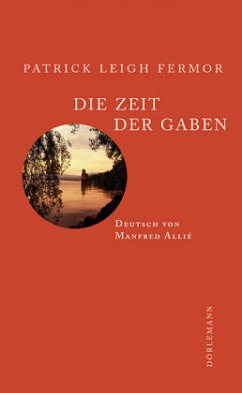Zu Fuß zum Meer, die Feder im GepäckEine der erstaunlichsten Reisen unserer Zeit!An einem verregneten Dezembertag macht sich der 18jährige Patrick Leigh Fermor zu Fuß, quer durch Europa, nach Konstantinopel auf. In dem Jahr, in dem Hitler an die Macht kommt, wandert der vielseitig interessierte junge Mann durch Wiesen und Wälder, verschneite Städte und die Salons der guten Gesellschaft. Er macht Bekanntschaft mit Handwerkern, Arbeitern und Direktoren, er nächtigt in ärmlichen Hospizen, Scheunen und auf märchenhaften Schlössern. Mit wachem Geist nimmt er nicht nur die Schönheit der Landschaften wahr, sondern erahnt das Heraufziehen des Sturms.In seiner poetischen und präzisen Sprache erzählt Patrick Leigh Fermor von Menschen und Begegnungen, Landschaften und Orten im Europa vor dem Krieg. Er läßt vor unserem inneren Auge noch einmal das alte Europa erstehen, das wenige Jahre später endgültig in Schutt und Asche versinkt.

Mit achtzehn: Patrick Leigh Fermors Reisen durch Europa
Ein Buch, dessen Protagonisten man so sehr beneidet, daß man auf der Stelle mit ihm tauschen will, liest sich mit der Leichtigkeit der Begeisterung und dem Schwermut der Sehnsucht. Jeder, der einen Funken Fernweh im Leib hat, beneidet Patrick Leigh Fermor - um seinen Mut, seine Tollkühnheit und um die Erlebnisse, die er dafür als Lebenserfahrungslohn erhielt. Fermor hatte eine wilde Jugend, eine unruhige Schulzeit, die Familie war kein Rückhalt, eine Karriere keine Verlockung, also beschloß er im Alter von achtzehn Jahren, nach Konstantinopel zu wandern, immer an Rhein und Donau entlang. Ein Pfund pro Woche als Reisegeld, ein Bändchen Horaz als Reiselektüre, dazu Rucksack, Wanderstab und Tagebuch: So verläßt er an einem eisgrauen Dezembertag des Jahres 1933 London. Er sollte es erst vier Jahre später wiedersehen.
Vierundvierzig Jahre nach seinem Aufbruch hat Fermor seine Reise in einer Trilogie beschrieben, deren erster, jetzt auf deutsch veröffentlichter Teil die Wanderschaft durch die Niederlande, Deutschland, Österreich und Tschechien bis zur ungarischen Grenze umfaßt; der zweite Band soll im nächsten Jahr auf deutsch erscheinen, an einem dritten arbeitet der neunzigjährige Fermor derzeit.
Vier Monate lang ist er im ersten Band unterwegs, meistens zu Fuß, manchmal auf Flußschiffen oder Lastwagen, wenn das Wetter allzu schaurig wird. Er übernachtet in Gasthäusern, Nachtasylen, Polizeistationen, Jugendherbergen, aber auch in Schlössern dank Empfehlungsschreiben und wohlwollender Gönner. Fermor schreibt zwar, er sei "Pilger, Wallfahrer, Ritter oder Held", doch er ist weder ein Huckleberry Finn noch ein Don Quijote, sondern ein neugieriger, aufgeweckter, gebildeter Junge auf seiner ganz eigenen "Grand Tour", die ihn nicht auf der klassischen Route nach Süden, sondern nach Südosten führt. Seine geistigen Reisebegleiter sind Byron und Winckelmann, und es ist kein Zufall, daß er hartnäckig von Konstantinopel oder Byzanz spricht, obwohl die Hüterin des Bosporus zu jener Zeit schon Istanbul hieß. Auch muß Fermor keine wirklichen Abenteuer bestehen, keine Notsituationen oder Existenzkrisen meistern. Immer wieder wird er eingeladen, verköstigt, weitergereicht - eine Erfahrung, die jeder kennt, der so jung wie er allein unterwegs gewesen und kaum irgendwo auf Mißtrauen gestoßen ist, weil niemand einem Schlechtes unterstellt; das ist das Privileg des Milchgesichts.
Es ist eine Wanderschaft durch eine Welt, die zu großen Teilen in Trümmern versunken ist, ein Opfer von Wahn und Krieg. Fermor schwärmt von Rotterdam, einer "wunderschönen Stadt", die im Bombenhagel unterging, und schreibt wehmütig: "Hätte ich das geahnt, wäre ich länger geblieben." Die Politik aber spielt keine Hauptrolle, Achtzehnjährige haben anderes im Kopf. Der Brite erschreckt sich über SA-Aufmärsche, registriert das Klima der Angst und die Verzagtheit der Nazi-Gegner, die schon nicht mehr die Stimme zu erheben wagen. Doch er zeichnet nicht das Bild Deutschlands im Schicksalsmoment der Gleichschaltung, sondern das Panorama eines gastfreundlichen, lebenslustigen, sympathischen Landes, das gerne singt, noch lieber ißt und am liebsten trinkt. In bester Erinnerung sind ihm die feuchten Abende mit Flußschiffern in den Spelunken von Köln, die warmherzigen Begegnungen mit bettelarmen Bauern oder die Partys in der sturmfreien Wohnung zweier höherer Töchter in Stuttgart.
Fermor, der zum Vorbild einer ganzen Garde von Reiseschriftstellern werden sollte, allen voran Chatwin und Theroux, sieht in Deutschland eher den geschichtsgetränkten Boden als die bedrohliche Gegenwart. Er rollt in Ulm beim Blick vom Münster den Dreißigjährigen Krieg auf, ist gefesselt von der Zeit Kaiser Maximilians I. und Karls V., die er zum "Goldenen Zeitalter" Deutschlands erklärt, und erkennt im Landsknecht das Symbol dieser Epoche. Das wirkt mitunter arg gelehrt und gesetzt. Viel besser ist Fermor ohnehin in den seltenen Momenten, in denen er sich gedankenlos ins Leben stürzt und es mit trockenen Humor beschreibt, etwa die fetten Zecher im Münchner Hofbräuhaus, deren Backen mit Fahrradpumpen aufgeblasen zu sein scheinen, und die Kellnerinnen, deren Statur ihn an Ringer erinnert.
Doch genau darin liegt das Dilemma des Buches: Fermor kann die Distanz von mehr als vierzig Jahren nicht leugnen, und er will es auch gar nicht. Er stützt sich zwar auf seine Tagebuchnotizen, aber aus ihnen spricht jetzt die Stimme eines welterfahrenen, lebensweisen Mannes. Das tut dem Text oft genug gut, denn es bremst das spätpubertäre Pathos des Achtzehnjährigen. Wenn man sich durch die wenigen Passagen aus dem Originaltagebuch müht, die Fermor als eine Art Leseproben einflicht, ist man froh, nicht vierhundert Seiten Jugendliteratur lesen zu müssen. Der Preis dafür ist allerdings hoch: der Verlust von Lebendigkeit und Unmittelbarkeit. Man ist nicht wirklich mit dem Achtzehnjährigen in einem umstürzenden Europa unterwegs, sondern läßt sich dessen Wanderschaft vom zweiundsechzigjährigen Reiseschriftsteller erzählen, der sich immer noch nicht für Politik interessiert, statt dessen gerne französische und lateinische Redewendungen in den Text streut, zu historischen Exkursen über Hannibal oder die Hunnen ansetzt und den Bogen von deutschen Duodezfürsten zum sagenhaft reichen Nizam von Hyderabad schlägt.
Das Ganze geschieht in einem Strom von Worten, keinem Rinnsal, sondern einem großen, breiten Fluß, so groß und breit wie die Flüsse, die Fermor auf seiner Wanderschaft begleiten. In ihnen schwimmen Schwärme von Adjektiven, Alliterationen und Metaphern, es rauscht von Strudeln der Pathetik und Phantasie, etwa wenn ein Leichenstein im Augsburger Dom beschrieben wird: "Ein Stück weiter war aus dem offenen Mund eines adlernasigen Eiferers, hohlwangig und hohläugig, das Todesröcheln beinahe zu hören." Und das sind die Momente, in denen man Patrick Leigh Fermor abermals beneidet, weil in ihm das Feuer der ungestümen, jugendliche Begeisterung, das Lodern des Großartigen auch nach vierzig Jahren noch immer nicht erloschen ist.
JAKOB STROBEL Y SERRA
Patrick Leigh Fermor: "Die Zeit der Gaben". Reisebeschreibung. Aus dem Englischen übersetzt von Manfred Allié. Dörlemann Verlag, Zürich 2005. 420 S., geb., 23,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Von Fernweh und Sehnsucht erfasst fühlt sich der Rezensent Jakob Strobel y Serra in Anbetracht der abenteuerlichen Reise, die der Brite Patrick Leigh Fermor 1933 als Achtzehnjähriger in Richtung Konstantinopel angetreten hat. Erst 44 Jahre später schrieb Fermor seine Erlebnisse in einer Trilogie nieder, deren erster Band jetzt auf Deutsch erschienen ist. Etwas irritiert notiert der Rezensent, dass Fermor seinen Aufenthalt im Dritten Reich als "Panorama eines gastfreundlichen, lebenslustigen, sympathischen Landes" anlegt, dessen Geschichte den jungen Reisenden mehr interessiert als die politische Gegenwart. Da Fermor aus der Erinnerung schreibt, und sich auf seine Tagebuchnotizen stützt, gehe zuweilen die Spontanität der Eindrücke verloren. Ausgeglichen werde dies jedoch durch Passagen, in denen Fermor seiner jugendlichen Begeisterung freien Lauf lässt, wie der insgesamt doch wohlwollende Rezensent festhält.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH