Nicht lieferbar
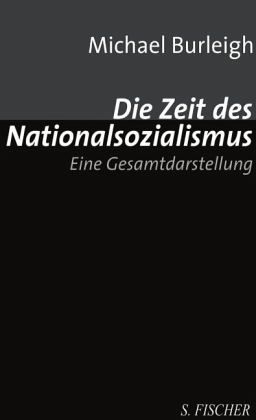
Die Zeit des Nationalsozialismus
Eine Gesamtdarstellung. Ausgezeichnet mit dem Samuel Johnson Prize 2001
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Auch nach jahrzehntelanger Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus stand die große historiographische Synthese bislang noch aus. Mit seiner Gesamtdarstellung des "Dritten Reiches" erfüllt der britische Historiker Michael Burleigh nun dieses Desiderat. Für Burleigh ist der Nationalsozialismus ein Phänomen, das bei all seinen spezifisch deutschen Eigenschaften ohne einen breiten europäischen Kontext nicht verstanden werden kann. Gerade mit einer solchen Perspektive gelingt es ihm, die singulären Züge des NS-Systems herauszustellen; gleichzeitig wird deutlich, wie sehr auch die europawe...
Auch nach jahrzehntelanger Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus stand die große historiographische Synthese bislang noch aus. Mit seiner Gesamtdarstellung des "Dritten Reiches" erfüllt der britische Historiker Michael Burleigh nun dieses Desiderat. Für Burleigh ist der Nationalsozialismus ein Phänomen, das bei all seinen spezifisch deutschen Eigenschaften ohne einen breiten europäischen Kontext nicht verstanden werden kann. Gerade mit einer solchen Perspektive gelingt es ihm, die singulären Züge des NS-Systems herauszustellen; gleichzeitig wird deutlich, wie sehr auch die europaweite Krise von Demokratie und Liberalismus die inhumane Politik der Nationalsozialisten begünstigte. Es geht dem Autor um Politikgeschichte, und es geht ihm vor allem um Ideen und Wertvorstellungen: Die NS-Bewegung war gleichsam religiöser Natur, ihr Erfolg hatte damit zu tun, dass sie den Menschen weit mehr als nur materielle Besserstellung versprach. "Das Buch befasst sich mit Wandlungen moralischer Kli mata; der Anziehungskraft einer Politik des Glaubens; der für den Nationalsozialismus spezifischen Mischung aus Träumen, Mythen, Ethno-Sentimentalität, bürokratischer und wissenschaftlicher Rationalität; und dem rauschhaften Sturz in eine beispiellose Kriminalität" (Michael Burleigh).
Burleighs Buch ist ein internationales Publikationsprojekt, das zeitgleich mit der deutschen Ausgabe in Großbritannien bei Macmillan, in den USA bei Farrar, Straus, Giroux und in Italien bei Rizzoli erscheint.
Burleighs Buch ist ein internationales Publikationsprojekt, das zeitgleich mit der deutschen Ausgabe in Großbritannien bei Macmillan, in den USA bei Farrar, Straus, Giroux und in Italien bei Rizzoli erscheint.



