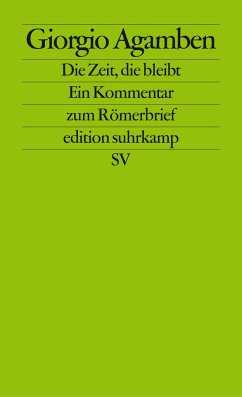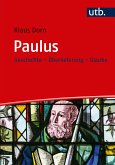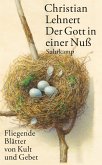Wenn es zutrifft, daß jedes Werk aus der Vergangenheit nur in bestimmten Momenten seiner Geschichte zu seiner ganzen Lesbarkeit gelangt, so scheint für die Briefe des Paulus die Zeit jetzt gekommen. Giorgio Agamben gibt ihnen jenen messianischen Stellenwert zurück, der allein die Perspektive einer nunmehr zweitausendjährigen Deutungstradition neu ausrichten kann: Paulus gründet keine universelle Religion, indem er eine neue Identität und eine neue Berufung ankündigt, sondern er widerruft jede Identität und jede Berufung; er schafft das alte Gesetz nicht ab, sondern öffnet es zu einem Gebrauch, der jenseits jeden Gesetzes liegt.
Von der Paulinischen Botschaft bis zu den Thesen Über den Begriff der Geschichte Walter Benjamins (die bisweilen außerordentliche Entlehnungen aus ihr enthalten) bildet die Umkehrung von Vergangenheit und Zukunft, von Erinnerung und Hoffnung das Herzstück des Messianismus. Die messianische Zeit ist die Jetztzeit; als Segment der profanen Zeit zwischen der W
Von der Paulinischen Botschaft bis zu den Thesen Über den Begriff der Geschichte Walter Benjamins (die bisweilen außerordentliche Entlehnungen aus ihr enthalten) bildet die Umkehrung von Vergangenheit und Zukunft, von Erinnerung und Hoffnung das Herzstück des Messianismus. Die messianische Zeit ist die Jetztzeit; als Segment der profanen Zeit zwischen der W
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Reserviert betrachtet Rezensent Ekkehard W. Stegemann diesen Kommentar zu Paulus' Römerbrief, den der Philosoph Giorgio Agamben vorgelegt hat. Merklich distanziert referiert er dessen Auslegung der messianischen Idee bei Paulus, die auf die "Aufhebung des Ausnahmezustands" ziele. Er kritisiert Agambens weitgehende Ausblendung des realgeschichtlichen politischen Kontextes der Römerbriefe. Die Auslegungen des Autors wirken auf Stegemann daher überaus blass. Auch scheinen sie ihm stark von Agambens Lektüre Benjamins und Carl Schmitts geprägt. Zudem hält er dem Autor vor, mit neueren historisch-kritischen und bibelwissenschaftlichen Diskursen völlig unvertraut zu sein und lediglich "marginale" und "veraltete" Texte konsultiert zu haben. Die neue Paulus-Perspektive sei ihm ebenso unbekannt wie die englischsprachige Forschung zu Paulus als Autor im Imperium Romanum. Ärgerlich findet er schließlich die zahlreichen philologischen Fehler, die einem vernünftigen Lektorat hätten auffallen müssen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Ein Philosoph liest die Bibel, und es raunt doch arg: Giorgio Agamben baut in den Römerbrief lustvoll ein paar messianische Schnitzer ein
Gott sei Dank für die Postmoderne! Da in ihr so allerlei möglich ist, geht es eben auch, daß ein Philosoph ernsthaft die Bibel liest. In mehreren Seminaren in den Jahren 1998/1999 hat sich Giorgio Agamben mit dem Römerbrief des Apostels Paulus beschäftigt. Die Ergebnisse dieses Nachdenkens, die im Jahr 2000 auf italienisch und französisch veröffentlicht wurden, liegen nun endlich auch in deutscher Sprache vor.
Der Ertrag ist erstaunlich: Was von der biblischen Exegese seit der Aufklärung einige Anstrengung fordert - nämlich über Lessings "garstigen Graben" zu springen -, gelingt hier scheinbar mühelos. Der heilige Text ist keine Archivalie, sondern sagt der Gegenwart die Zeit an. Quid de nocte? - "Wie weit ist die Nacht?" (Jesaja 21,11). Es ist höchste Zeit, tönt die Stimme des Veroneser Wächters Agamben.
Das Hexameron (in der poetischen Form der Sestine mit Schlußstrophe - tornada) des italienischen Philosophen lädt ein zur Lektüre der ersten zehn Wörter des Paulus-Briefes: "Paulus, zum Sklaven des Messias Jesus berufen, als Apostel, ausgesondert für die Verkündigung Gottes", wie Agamben übersetzt. Nur diese zehn Wörter, auf sechs Seminartage verteilt - und doch so viel: Aus der paulinischen Theologie, aus Talmud und Tyconius, Benjamin und Benveniste, Hegel und Heidegger (der in jungen Jahren selbst einmal eine Vorlesung zu Paulus hielt), Schopenhauer und Schmitt (merkwürdigerweise fällt der Name Erik Petersons nicht).
Natürlich will diese ideen- und assoziationsreiche, bisweilen schwindelerregende Achterbahnfahrt durch die Geschichte des abendländischen Geistes auch das Staunen lehren: Das Publikum hat gezahlt; dem Publikum wird allerlei geboten. Etwa über den "guten Gebrauch des Klatschs" (ausgehend von der Apostelgeschichte des Lukas), über die Gemeinsamkeit von Talmud und Pandekten des Corpus Iuris Civilis, über die Teilung der Linie durch den Schnitt des Apelles oder über die Erfindung des End-Reims (man reibt sich die Augen: Paulus soll es gewesen sein!).
Aber zuletzt geht es doch nicht um die große Schau, das divertimento oder das Spiel der Intertextualität. Sondern sehr ernsthaft darum, "die Bedeutung der Paulinischen Briefe als grundlegenden messianischen Text der westlichen Kultur wiederherzustellen" und damit die uns bleibende Zeit (1. Korinther 7,29) zu verstehen. Ein letzter Rettungsversuch?
Mit dem "Messianischen" ist die Kategorie genannt, welche die Brücke über den Graben zu schlagen vermag. Das eine Ende des Bogens ist durch Benjamins Rede vom Messianischen, genauer von der "schwachen messianischen Kraft" (Über den Begriff der Geschichte, These 2), gesetzt. Jacob Taubes hatte in seiner Fragment gebliebenen Vorlesungsreihe zur "politischen Theologie des Paulus" (1993) schon die Beziehung dieses Textes zum Völkerapostel und seiner Rede von der (messianischen) "Kraft in Schwachheit" hergestellt. Agamben nimmt diese Anregung auf: Paulus und Benjamin - die "beiden höchsten messianischen Texte unserer Tradition"!
Es geht nicht nur um das geistreiche Spiel der Beziehungen, nicht um das unendlich und gelassene Geschäft der Interpretation, sondern um das "Jetzt der Lesbarkeit" und Erkennbarkeit, das heißt um die Wahrnehmung der Krise und des kairos. Der Philosoph als Prophet? Oder arbeitet er schon, durch die poetische Form, an seiner relecture, seiner Kanonisierung? Bisweilen raunt es doch arg in Agambens zum Sprung bereiten Exegesen.
Der von Paulus verkündete Glaube an den Christos Iesous ist Glaube an den Messias Jesus. Genauer und im Anschluß an Überlegungen Émile Benvenistes zum Nominalsatz: "Messias ist kein Prädikat, das dem Subjekt Jesus hinzugefügt werden könnte, sondern, das untrennbar von ihm ist, ohne deshalb einen Eigennamen zu bilden." Die von Paulus beschriebene Existenz "in Christus" ist also messianische Existenz, die Ekklesia (ein Wort, das man im Sinne Agambens gewiß nicht als "Kirche" verstehen darf!) "messianische Gemeinschaft".
Was bedeutet die messianische Existenz für das Subjekt? Die messianische Berufung ist kein Standpunkt, von dem aus die Welt als erlöste anzusehen wäre. Sie gibt keine neue Identität. Sie ist eine Annullierung des Subjekts, der Repräsentation und Gleichnisse des "Alsob". Das Messianische setzt jede Berufung, jeden Beruf und Stand in Spannung zu sich selbst: Es ist die paulinische Figur des "Als ob nicht", nicht im Sinne der Negation, sondern der Nicht-Identität, die einen unausgesprochenen und unbedeutenden Rest läßt. Für Paulus, so meint Agamben, ist dies das Kennzeichen der messianischen Gegenwart: Rest zu sein, in der Nicht-Identität auszuhalten, Gottes eingedenk in einer Welt ohne Gott (Dietrich Bonhoeffer), in einer Gegenwart, die als "Forderung nach Vollendung" qualifiziert wird. Diese "messianische Inversion" betrifft Recht und Gesetz und Politik, Zeit und Sprache. Ihre Erlösung, so scheint es, ereignet sich für Agamben nicht in der theologischen oder sonstigen Apokalypse, sondern in der erinnernden Rekapitulation, der Vereinigung von Vergangenheit und Gegenwart im Akt des Lesens.
Gewiß, die mutige Grenzüberschreitung, die selbst so sehr auf philologisch-historische Exaktheit pocht, geht nicht ohne handwerkliche Schnitzer ab. Übergangen wird die von der kritischen Exegese erarbeitete Unterscheidung echter und deuteropaulinischer Briefe. Das ist keine Kleinigkeit, denn etwa die im Epheserbrief entwickelte Sicht auf das Verhältnis von Juden und Heiden ist eine deutlich andere als die des wahrscheinlich "echten" Paulus. So geht es wohl doch um "kanonische" oder rezeptionsgeschichtliche Lektüre.
Doch kann man dann kaum den Text so gegen seine Inanspruchnahme (etwa in der theologischen Christologie) ausspielen, wie der Autor das gelegentlich gerne tut: Die Paulus-Exegese beginnt im Neuen Testament selbst. Als einziger Fachkommentar zum Römerbrief wird ein recht entlegenes Werk aus dem Jahr 1957 zitiert und natürlich kritisiert. Als ob es nicht seit mindestens drei Dezennien eine "neue Perspektive" auf die Theologie des Apostels, ja eine Wiederentdeckung des jüdischen und sogar des vorchristlichen Paulus gäbe! Und dies gewiß auch, aber keineswegs nur durch "jüdische Gelehrte aus Jerusalem, Berlin und den Vereinigten Staaten". Die Forderung, ein "technisches Wörterbuch des Paulus" zu erstellen (wozu Agamben mit seiner Kommentierung schon einen ersten Beitrag leisten will), ist nicht hinreichend gegen neue Versuchungen zu philosophischem oder theologischem Begriffs-Tiefsinn gefeit - Versuchungen, welche die theologisch-exegetische Zunft mühsam genug überwunden zu haben glaubte. Mancher Gegensatz ist zu grob geschnitten: zwischen Messianologie und Christologie, zwischen Glaubenswort und Dogma, zwischen den Evangelien und Paulus.
Daneben aber zeugt es nicht bloß vom Sinn für den intellektuellem Kitzel, sondern von eindringendem Sachverstand, wenn Agamben etwa David Flussers ebenso kluge wie kratzbürstige Kritik an Bubers Unterscheidung von "zwei Glaubensweisen" - dort steht das griechische "Für-wahr-Halten" gegen das jüdische "Vertrauen" - weiterdenkt und auf die Sphäre des Rechts bezieht. Man wird auch theologisch neu über den Glauben nachzudenken haben. Wenn er Überlegungen (Paul Rioeurs und) Eberhard Jüngels aufnehmend, die messianische Redeform des Gleichnisses als Annäherung von Zeichen und Bezeichnetem beschreibt, in der "die bedeutete Sache die Sprache selbst ist" (Markus 4,14: "Der Sämann sät das Wort"). Wenn er die immer noch herumgeisternde Denkfigur der Diastase von antikem Judentum und Hellenismus darin aufhebt, daß er erkennt: "Es gibt nichts, was rein jüdischer wäre, als in einer Exilsprache zu wohnen." Wenn er die gesellschaftliche Gegenwart durch eine "vollständige Juridisierung der menschlichen Verhältnisse, die Verwirrung von dem, was wir glauben, hoffen und lieben können, und von dem, was wir machen müssen und machen dürfen", bedroht sieht und als Krise der Religion wie des Rechts zu verstehen gibt.
Die die gegenwärtige Debatte um die Wiederkehr der Religion mitprägende Unterscheidung in laizistische und fundamentalistisch-religiöse Staaten erscheint in dieser Perspektive als vordergründig, sie "verdeckt denselben politischen Niedergang". Eine verstörende Wahrheit.
"Wächter, wie weit ist die Nacht?" Beim Lesen von Agambens erbaulichem Gedicht vergeht sie im Flug.
HERMUT LÖHR
Giorgio Agamben: "Die Zeit, die bleibt". Ein Kommentar zum Römerbrief. Aus dem Italienischen von Davide Giuriato, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag 2006. 234 S., br., 11,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main