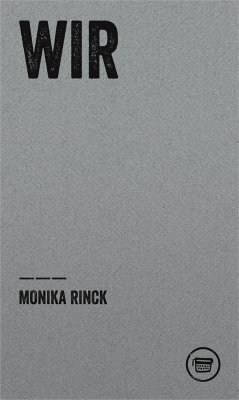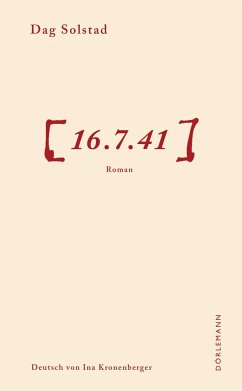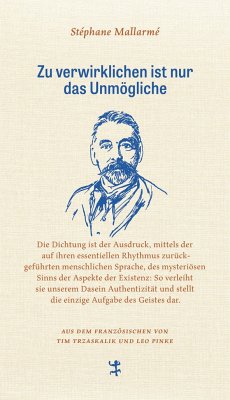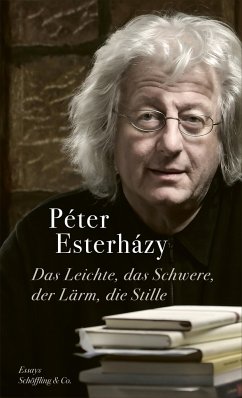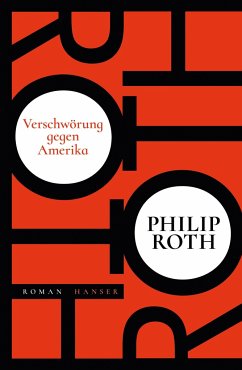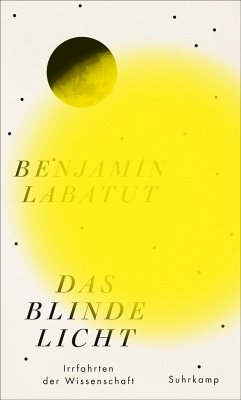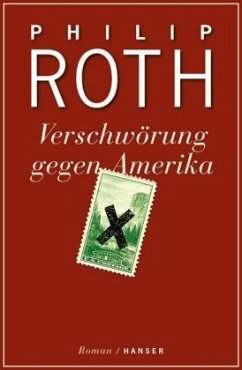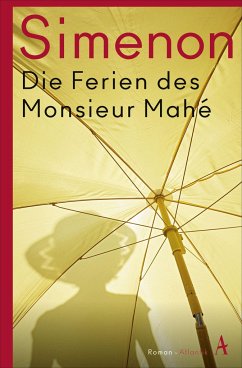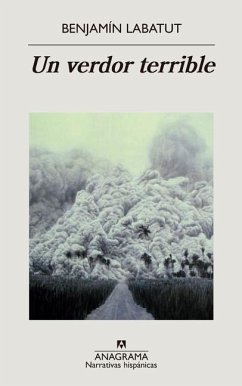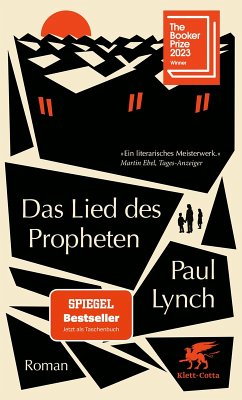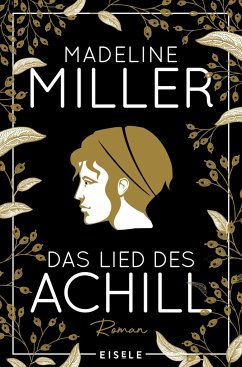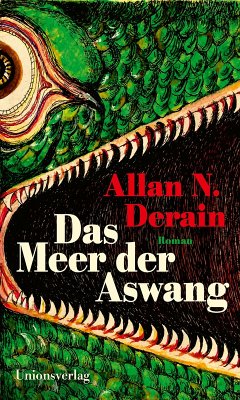Die Zeitinsel
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
27,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Durch neun Epochenkreise - von der morgigen Gegenwart bis zurück in die Welt der Mythen - lasst Felix Philipp Ingold seine Icherzahler und -erzahlerinnen eine kleine Mittelmeerinsel erkunden, die vermeintlich keine Geschichte hat, die eine solche aber grade dadurch gewinnt, dass immer wieder jemand anderes sie berichtet. Unter wechselnden Namen wird die Insel zum Schauplatz - zu einer Art Welttheater - für wechselnde tragikomische Episoden in wechselnder Besetzung. Fiktive und reale Mitspieler kommen gleichermaßen zu Wort als Zeitzeugen, die ihre Zeit weniger bezeugen, als dass sie sie erze...
Durch neun Epochenkreise - von der morgigen Gegenwart bis zurück in die Welt der Mythen - lasst Felix Philipp Ingold seine Icherzahler und -erzahlerinnen eine kleine Mittelmeerinsel erkunden, die vermeintlich keine Geschichte hat, die eine solche aber grade dadurch gewinnt, dass immer wieder jemand anderes sie berichtet. Unter wechselnden Namen wird die Insel zum Schauplatz - zu einer Art Welttheater - für wechselnde tragikomische Episoden in wechselnder Besetzung. Fiktive und reale Mitspieler kommen gleichermaßen zu Wort als Zeitzeugen, die ihre Zeit weniger bezeugen, als dass sie sie erzeugen, sie also beim Reden oder Schreiben überhaupt erst hervorbringen. Ein Oligarch, ein Filmemacher, ein Literat, eine Sekretarin, eine Malerin, ein Bildungsreisender, ein Wandermonch, eine Wunschfrau bringen "Leben" auf die Insel und - bezahlen es mit dem Tod.Unmerkliche Verrückungen und Verschiebungen, die der Autor an scheinbar realistischen Settings vornimmt, lassen uns umso aufmerksamer werden für die Konstruiertheit jeglichen Berichts und machen solcher Art die Durchlassigkeit der Grenzen zwischen Fakt und Fiktion nachempfindbar. Felix Philipp Ingolds "Neun Episoden" verheißen Entdeckerfreuden in dem durchaus noch nicht restlos erforschten Archipel zeitgemaßer Erzahlmoglichkeiten.