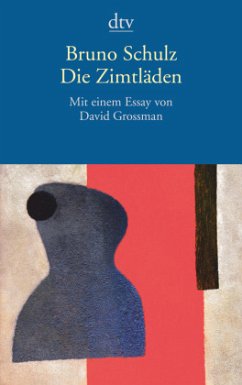Diese vom Autor selbst illustrierte Sammlung phantastischer Erzählungen in der brillanten Neuübersetzung von Doreen Daume lässt eintauchen in die versunkene Welt eines galizischen Städtchens und seiner Bewohner. Schein und Wirklichkeit verschwimmen in der wunderlichen Umgebung, in der die Menschen berauschende Sommertage, aber auch stockfinstere Sturmnächte erleben - kunstvoll sucht Schulz nach dem »mythischen Gehalt, nach dem letzten Sinn der Geschichte«.
Auch dieses wunderbare schräge und einzigartige Buch hat seine geheimen Knoten, und man möchte es nie mehr aus der Hand legen.
Julian Schütt Basler Zeitung 20120415
Julian Schütt Basler Zeitung 20120415

Nicht Schtetl, sondern Stadt: Der polnische Erzähler Bruno Schulz war ein Riese der literarischen Moderne, wie eine neue Übersetzung seiner "Zimtläden" beweist. Zugleich erscheint nun auch die maßgebliche Biographie von Jerzy Ficowski endlich auf Deutsch.
Wer weiß, was aus Bruno Schulz geworden wäre, wenn er den 19. November 1942 überlebt hätte. Just für diesen Tag hatte der Dichter und Maler seine Flucht aus dem Getto des galizischen Drohobycz geplant. Er trug die gefälschten Papiere schon in der Tasche, als er auf offener Straße von dem SS-Scharführer Karl Günther erschossen wurde. Schulz war nicht das einzige Opfer dieser willkürlichen Tötungsaktion, bei der über hundert Juden innerhalb weniger Stunden im Kugelhagel der Herrenmenschen starben; der 19. November ging als Schwarzer Donnerstag ins Gedächtnis der Überlebenden ein.
Nehmen wir einmal an, Schulz, der neun Jahre zuvor als Schriftsteller debütiert und in der polnischen Kritik mit seinen "Zimtläden" zugleich überschwengliche und verständnislose Reaktionen hervorgerufen hatte, wäre die Flucht gelungen. Nehmen wir an, er hätte in Warschau überlebt, weiter geschrieben und veröffentlicht. Dann hätte wohl auch seine Rezeptionsgeschichte einen anderen Verlauf genommen. Nun ist es nicht so, dass die wenigen hundert Seiten des Schulzschen Werkes, die die Zeiten überdauert haben, nicht längst zur Weltliteratur gezählt würden. Die tragischen Todesumstände des Autors färben aber bis heute den Blick auf seine literarische Stellung: Schulz gilt als ein Hauptprotagonist des jüdischen intellektuellen Lebens im damaligen Polen; eine Figur, die an die barbarische Ausrottung dieses Lebens durch die Nazis gemahnt.
Als 2003 in Drohobycz, das heute in der Ukraine liegt, einige Wandbilder entdeckt wurden, die Schulz im Auftrag des SS-Manns Felix Landau dort angebracht hatte, wurden Teile davon mit ukrainischer Zustimmung nach Israel verbracht, wo sie nun in Yad Vashem zu sehen sind. Diese klandestin durchgeführte Aktion provozierte damals heftige Proteste der Polen, die Schulz dem genuinen Erbe ihres eigenen Landes zurechnen. Abseits dieses Gerangels um die Zugehörigkeit der Opferfigur Schulz greift eine weitere Sortierung. Wie Joseph Roth, Leopold von Sacher-Masoch und Karl-Emil Franzos ist Bruno Schulz weithin als galizischer Dichter in Erinnerung geblieben, zudem als einer, der die Welt des jüdischen Schtetls in Literatur gefasst hat.
Dabei erscheint das osteuropäische Schtetl, das bis ins zwanzigste Jahrhundert überdauert hatte, als genuin antimoderner Raum, der im Grunde genommen auch eine eigene Zeit ist: ein ewiges und verschrobenes Mittelalter, mit dem Pejes und Schtreimel der Chassiden, kabbalistische Mystik, schmale Gässchen und windschiefe Häuser assoziiert werden. In diesem territorialen Paradigma der Literaturbetrachtung ist ein gleichsam orientalistisches Moment enthalten, eine exotistische Wahrnehmungsfolie, die ein aus der Zeit gefallenes, vermeintlich archaisches und ursprüngliches Judentum überhaupt erst konstruiert.
Dabei hat Bruno Schulz in dieser Ecke nichts verloren. Seine Literatur gehört durch und durch der Moderne und Avantgarde an, so dass es kaum eine Rolle spielt, dass Schulz in Drohobycz gedacht und gedichtet hat und nicht in Berlin, Wien oder Paris. Schulz ist ein Riese der literarischen Moderne, und so waren diese beiden Neuerscheinungen längst überfällig: Jerzy Ficowskis einschlägige Biographie des Autors und eine von Doreen Daume besorgte Neuübersetzung der "Zimtläden".
Bei diesem 1933 auf Polnisch erschienenen und 1961 zum ersten Mal ins Deutsche übertragenen Hauptwerk des Autors handelt es sich um einen Zyklus kürzerer jeweils in sich geschlossener Prosastücke. Nicht auszuschließen, dass Schulz bei dem Ort, in dem all diese Erzählungen spielen, bisweilen an seine Heimatstadt Drohobycz gedacht haben mag. Bestimmt nicht zufällig hat der Dichter aber auf einen Ortsnamen verzichtet, die Wirklichkeit seines Schreibens ist von einer höheren Potenz. Die Welt der "Zimtläden" gehört bis in die letzte Faser dem Traum, dem Mythos und der Illusion an.
Schulz, der sich in poetologischen Passagen immer wieder erklärt, ist orthodoxer Platoniker: "Wir halten das Wort üblicherweise für den Schatten der Wirklichkeit, für ihr Abbild. Richtiger wäre die umgekehrte Behauptung: Die Wirklichkeit ist der Schatten des Wortes." Was für Schulz, den Schriftsteller, bedeutet, dass seine Literatur buchstäblich so viel wert ist wie das Medium, auf dem er sie notiert: "Diese Wirklichkeit ist dünn wie Papier, und jeder Spalt verrät, dass sie bloß imitiert ist." Ist Bruno Schulz damit ein Vordenker der virtuellen Realität, hat er McLuhans Medienbegriff vorausgeahnt?
Wo die Wirklichkeit nichts anderes ist als ein Arsenal von Zeichen, lösen sich wie von selbst die Grenzen zwischen Organischem und Anorganischem auf und die Übergänge von Mensch zu Tier und Maschine. Die "Zimtläden" sind eine moderne Version der Ovidschen Metamorphosen, allerdings in pessimistischer Wendung. Schulz erzählt schließlich nicht von einer künstlichen Belebung zunächst toten Materials, sondern von der totengleichen Erstarrung des vermeintlich Lebendigen.
In der Erzählung "Die Nacht der großen Saison" trügt ein am Himmel vorüberziehender Vogelschwarm den Erzähler nur zunächst darüber hinweg, dass dieses Bild nichts als die hohnlachende Mahnung an einen längst zerstörten Naturzustand ist. Wie sich nämlich zeigt, sind diese Vögel "innen hohl und ohne Leben. Alle Vitalität war ins Gefieder übergegangen und ins Phantastische ausgeufert. Es war wie ein Museum ausrangierter Arten, wie die Rumpelkammer eines Vogelparadieses."
Worin besteht der Sündenfall, der diese Erstarrung und Aushöhlung zum Preis hatte? Vieles spricht dafür, dass Schulz hier die schockhafte Erfahrung einer Moderne literarisiert, die in den dreißiger Jahren längst ins polnische Galizien vorgedrungen war. Erdölfunde hatten zu einer regelrechten Klondike-Stimmung geführt, die mit neuen Förderanlagen auch ein bis dato unbekanntes Industrieproletariat entstehen ließ. Wie andere expressionistische Großstadtdichter auch reagiert Schulz sensibel auf die beginnende Urbanisierung und Maschinisierung.
In "Die Krokodilstraße" lässt er herrenlose Droschken vorüberrauschen und Eisenbahnen auf nicht festgelegten Routen fahren und überraschend aus Nebenstraßen auftauchen. Die Maschinen führen ein Eigenleben, während der Fluss aus Verkehr und Geld wie von selbst vorüberrauscht. Menschen führen in diesem Raum allenfalls einen Marionettenreigen auf, sie sind Teil einer "Simulation der Materie, die sich den Schein des Lebens umgehängt hatte".
Nur manchmal ragt aus dieser Simulation, gleichsam als Rest, der Mensch heraus. Wie Schulz solche Momentaufnahmen zeichnet, erinnert an Roland Barthes' fotografietheoretischen Begriff des punctum. Es handelt sich um das Aufblitzen eines vormals Lebendigen, das sich als melancholische Erfahrung des Unwiederbringlichen ins Bild fräst: "Nur manchmal", so heißt es in der "Krokodilstraße", "können wir in dem vielköpfigen Gewühl einen dunklen, lebendigen Blick erhaschen, eine tief in die Stirn gedrückte, schwarze Melone, ein halbes von einem Lächeln zerrissenes Gesicht, dessen Mund gerade etwas gesagt hat, ein vorgeschobenes und mitten im Schritt für immer erstarrtes Bein." Wenn die Fotografie für Barthes das Medium für die Wiederkehr der Toten ist, gilt das im selben Maß für die Literatur von Bruno Schulz.
Dass Doreen Daume das Prosastück mit "Krokodilstraße" übersetzt und damit die ältere deutsche Übersetzung korrigiert, in der es "Krokodilgasse" geheißen hatte, zeigt übrigens beispielhaft die sprachliche Sensibilität, mit der sie dem Text in seiner historischen und intellektuellen Relevanz begegnet. Die Differenz zwischen Gasse und Straße ist nichts anderes als die Differenz zwischen Schtetl und Stadt. Und Bruno Schulz ist alles andere als ein Chronist jüdischen Lebens in Galizien. Seine Moderne ist, um einen passenden Lektürekontext zu benennen, die Moderne der Zeitgenossen Kracauer und Benjamin.
Vielleicht ist der isolierte, "werkimmanente" Blick, der solche Verbindungen zwangsläufig übersieht, die größte Schwäche von Jerzy Ficowskis Schulz-Biographie. Man muss dem Autor das aber nicht zum Vorwurf machen. Ohne die unermüdlichen Nachforschungen des passionierten Biographen, der Bruno Schulz als Achtzehnjähriger einen schicksalsbedingt unbeantworteten Brief geschickt hatte, wäre Schulz, zunächst im poststalinistischen Polen, kaum bekannt geworden. Ficowski ist für Schulz, was Max Brod für Franz Kafka war: selbst ein Literat und vielleicht auch deshalb kein ganz objektiver Nachlassverwalter. Die 1967 zum ersten Mal erschienene Biographie wurde für eine polnische Neuausgabe im Jahr 2002 noch einmal überarbeitet, bevor sie unter dem Titel "Bruno Schulz - ein Künstlerleben in Galizien" nun auch auf Deutsch vorliegt.
Ficowski versucht sich darin in einer möglichst vollständigen biographischen Rekonstruktion und wartet mit einer Datenfülle auf, die sein Buch zu einer zentralen Quelle der Schulz-Forschung macht. Das mag auch die hagiographischen Züge seines zuweilen besessenen close reading entschuldigen. Und auch den offenbar eifersüchtigen Reflex, aus dem heraus Ficowski eher abschätzig über die Dichterin Debora Vogel, diese langjährige Briefpartnerin von Bruno Schulz, schreibt. Vogels literarisches Schaffen sei, so Ficowski, nicht weiter von Belang, sie selbst nur als wichtigste Muse des Autors interessant.
Das kann so nicht stehenbleiben. Debora Vogel, der Schulz seine "Zimtläden" zunächst fortlaufend in Briefen geschickt hatte, war, bis auch sie von den Nationalsozialisten ermordet wurde, selbst eine erstklassige Dichterin. Sie schrieb zum Teil auf Jiddisch, das sie sich selbst angeeignet hatte und wie eine Kunstsprache für radikale Textmontagen verwendete. Bruno Schulz ist nun endlich hervorragend ins Deutsche übersetzt worden - Debora Vogel sollte es noch werden.
STEFANIE PETER
Bruno Schulz: "Die Zimtläden". Aus dem Polnischen übersetzt von Doreen Daume. Carl Hanser Verlag, München 2008. 232 S., geb., 21,50 [Euro].
Jerzy Ficowski: "Bruno Schulz 1892-1942". Ein Künstlerleben in Galizien. Aus dem Polnischen übersetzt und für die deutsche Ausgabe bearbeitet von Friedrich Griese. Carl Hanser Verlag, München 2008. 185 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Mit großer Freude hat Rezensentin Stefanie Peter den Erzählband "Zimtläden" des polnischen Erzählers Bruno Schulz (1892-1942) aufgenommen, der endlich in einer neuen deutschen Übersetzung vorliegt. Der bei seiner versuchten Flucht aus dem Getto von Drohobycz 1942 von einem SS-Mann ermordete Autor ist nach Peters Ansicht als galizischer Dichter in Erinnerung geblieben, als ein Schriftsteller, der die Welt der jüdischen Schtetls in Literatur gefasst hat - ein Eindruck, dem sie nur widersprechen kann. Demgegenüber akzentuiert sie die Modernität dieses Schriftstellers, würdigt ihn als "Riesen der literarischen Moderne" und stellt ihn in den Kontext Benjamins und Kracauers. Sie erläutert die Rolle von Traum, Mythos und Illusion in seinem Werk, versteht die Wirklichkeit darin als "Arsenal von Zeichen" und findet in den Texten die literarische Gestaltung des Schocks der Moderne. Lobend spricht Peter auch über die Übersetzung von Doreen Daume, der sie hohe "sprachliche Sensibilität" bescheinigt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH