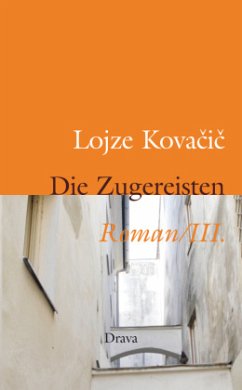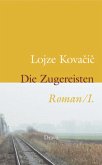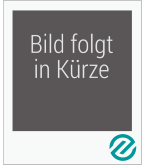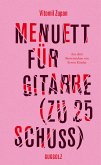Der dritte Teil der Trilogie umfasst die selten thematisierten ersten Jahre des sozialistischen Jugoslawien bis zum Bruch zwischen Tito und Stalin im Jahr 1948. Am Anfang steht der Einzug der Partisanenarmee in das von den deutschen Truppen verlassene Ljubljana. In dichten, sich ständig wandelnden Szenen beschreibt Kovacic das Gemisch aus Freude, Duckmäusertum und Aggressivität, das sich zu einem rauschhaften Volksfest steigert. Und mitten durch das Gedränge, getrieben von der Angst, als "Deutsche" erkannt zu werden, irrt diese Rumpffamilie, für die der Erzähler, kaum siebzehnjährig, die Verantwortung trägt: Mutter und Schwester, die nicht Slowenisch können, dazu die gehbehinderte Nichte im Leiterwagen.Zwei Welten, er steht in beiden, oder zwischendrin, vermitteln kann er nicht. Die Angehörigen werden ausgewiesen (wochenlang zwischen der jugoslawischen und österreichischen Grenze hin- und hergeschoben), er bleibt zurück, von Selbstvorwürfen geplagt, muss sich durchschlagen, manchmal durchmogeln, hin- und hergerissen zwischen Anpassung und Aufbegehren. Und findet nach und nach, indem er sich immer wieder mit dem Tod des Vaters auseinandersetzt, im Schreiben, das ihm zur »dritten Sprache« wird, so etwas wie eine erste, prekäre Heimat.In der literarischen Szene, die ihn neugierig beäugt und herumreicht, bleibt er, der ganz genau hinsieht, worüber andere lieber hinwegsehen, ein Underdog und Außenseiter. Nichts anderes will er werden, als was er von Anbeginn ist: peinlicher Beobachter und Chronist eines verrückten Zeitalters.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Ein autobiographischer Roman des Slowenen Lojze Kovacic
Der autobiographische Roman erfreut sich in der gegenwärtigen europäischen Literaturlandschaft wachsender Beliebtheit. Der Slowene Lojze Kovacic, 1928 in Basel geboren und im Mai dieses Jahres in Ljubljana verstorben, bietet mit seinem Roman "Die Zugereisten", dessen erster Teil jetzt in der ausgezeichneten Übersetzung von Klaus Detlef Olof vorliegt, eine besondere Variante der fiktionalisierten Rückschau auf das eigene Leben. Und dies verlief eigentümlich genug.
Kovacics Vater, ein slowenischer Kürschner, war vor dem Ersten Weltkrieg in die Schweiz ausgewandert und hatte eine Deutsche geheiratet. Im Beruf zunächst erfolgreich, geriet er vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in wirtschaftliche Bedrängnis und kehrte 1938 in seine slowenische Heimat zurück. Die "Zugereisten" sind also Wirtschaftsmigranten, die, bis auf den Vater, die Sprache ihrer neuen Heimat nicht verstehen und denen die Einheimischen mit Mißtrauen begegnen.
Der Reiz der autobiographischen Romane beruht auf der Rekonstruktion der Weltentdeckung des kindlichen Subjekts. Es gilt, die Menschen, von Respektspersonen über seltsame Zeitgenossen und absonderliche Typen bis hin zu den wenig friedfertigen Spielkameraden, zu enträtseln. Die Dinge, von den Gerätschaften der ländlichen Welt bis hin zu Lokomotiven, Waffen und Flugzeugen, werden beäugt, Landschaften, Pflanzen und Tiere bewundernd wahrgenommen. Das "neue Sehen", das nach der formalistischen Doktrin durch Verfremdung bewirkt werden soll, ist das grundlegende literarische Prinzip der Gattung.
Lockt Viktor Jerofejew etwa mit dem unerlaubten Blick hinter die Vorhänge der stalinistischen Diplomatie (um nur ein anderes aktuelles Beispiel heranzuziehen), so versucht sich Kovacic an der nicht minder schwierigen Aufgabe, seinen Lojzek vor die Schwelle des ihm fremden Slowenisch zu stellen, einer Sprache, die mit ihrer archaischen Grammatik und Lexik zu den schwierigsten in Europa zählt und phonetisch wohl nur von den Einheimischen zu bewältigen ist. Immer wieder produziert Lojzek in Kirche oder Schule groteske Mißverständnisse, weil er die slowenischen Verschlußlaute behaucht oder ähnlich klingende Wörter verwechselt. Die Irrwege im Labyrinth der Zweisprachigkeiten sind im Text markiert (die im Original deutschen Wörter und Sätze sind kursiv gesetzt) oder erläutert. Oft schweigt der Knabe, wenn er nichts begreift, aber dann vermerkt er wieder: "Eine Sprache, die man nicht versteht, kann ab und zu angenehm sein ... Sie ist wie eine Art Nebel im Kopf."
Von der Polizei eskortiert, hatte die Familie Basel verlassen; in Slowenien fand sie zunächst auf dem Bauernhof eines Onkels Unterschlupf, später in Ljubljana. Armut, Hunger, primitivste Wohnverhältnisse - man schläft zu viert in einem Bett - und nicht zuletzt das Gefühl, in der neuen Heimat unwillkommen zu sein, nagen am Lebensmut und Wertgefühl der Familie. Der schöne, zerbrechliche, lungenkranke Vati arbeitet für einen Hungerlohn in einer Kleiderfabrik; Lojzek geht mit der älteren Schwester Clairi, einer hübschen unverheirateten Mutter, hausieren und lernt auf Betteltour die Tricks, mit denen man mildtätige Gaben erlangt. Er treibt sich im Schlachthof und unter Zigeunern herum, gehört einer Jungenbande an, die sich mit einer anderen strategisch geplante Kämpfe liefert. Da die Miete nicht gezahlt werden kann, muß die Familie mehrfach, unter dem Gespött der Passanten, umziehen - von einer Bruchbude in die nächste.
Diese soziale Misere ist ein fruchtbarer Nährboden für die Parolen des Nationalsozialismus. Bei Schnaps und Speck erklärt Feldwebel Milic Lojzeks Vati, Hitler werde allen Armen der Welt Wohlstand bringen, was der Vater gerne glauben will. Als er in der Zeitung am Zaun die Nachricht vom Abschluß des Hitler-Stalin-Paktes liest, kommt er verwirrt zurück: "Juden und Deutsche zusammen! Im Traum hätte ich das nicht geglaubt ...".
Lojzek, dessen politisches Weltbild noch nicht verfestigt ist, registriert dies wie alles andere auch - und hängt seinen Träumen und Phantasien nach. Eine der auffallendsten Erscheinungen im Roman, an die sich der Leser freilich rasch gewöhnt, sind Auslassungspunkte anstelle des satzschließenden einen Punktes. Mit diesem Auslassen der Hauptsache - in der Rhetorik spricht man von Aposiopese - wird bei Lojze Kovacic das mögliche Weiterdenken über das Geschilderte hinaus angedeutet. Oft aber sind die Phantasien des Knaben auch ausgeführt, etwa beim Verlassen Basels im Eisenbahnwaggon, beim nächtlichen Durchwandern eines Hohlwegs, beim Streifen durch Wald und Feld.
Natürlich ist, wie in vielen autobiographischen Romanen, die Neugier des jungen Helden vor allem auf das große Rätsel des Sexus gerichtet. Was er da in seinen frühen Jahre alles mitbekommt, ist nicht wenig. Schon nach der Ankunft im slowenischen Dorf verzaubert ihn die Schönheit seiner Cousine Stanka. Aber er kann den Blick auch nicht von den fetten Busen oder der "schwarzen Brücke zwischen den Schenkeln" unförmiger Frauen abwenden. Mit Anica oder Adrijana treibt er schon mal harmlose Spielchen, doch gilt seine Verehrung schönen, reinen, engelsgleichen Frauen wie der Mutter seines Freundes Enrico oder dem blonden Dürrchen Tatjana im weißen Kleid mit den schwarzen Streifen.
Bemerkenswert ist, wie Hitlers Kriegspolitik und seine militärischen Erfolge in den unterschiedlichen Bevölkerungskreisen beobachtet werden. Vater und Mutter werden plötzlich in eine undurchsichtige Gesellschaft hineingezogen, die sich bald als eine Art fünfter Kolonne von Kryptonazis und Kollaborateuren entpuppt. Vati, auf die lang ersehnte Anerkennung hoffend, legt seinem Sohn schließlich nahe, der Hitlerjugend beizutreten.
In der Schlußpassage des Romans schildert der Knabe Lojzek die Besetzung Ljubljanas im April 1941. Es wimmelt von ungarischen, deutschen und italienischen Soldaten. Lojzes genauer Blick bestätigt die alten Stereotype: "Ungewöhnlich waren die Uniformen der Honved-Offiziere: statt der Knöpfe hatten sie Holzhäkchen, auf der Brust Ösen und auf dem Kopf runde Kappen mit Federn ... Die Carabinieri trugen Napoleonhüte ... Die Deutschen in ihren angegossen knappen Uniformen waren die einzigen, die richtigen Kämpfern ähnlich sahen ... Die italienischen Soldaten waren inmitten der ernsten Stadt, voller Bücher und gebildeter Menschen, wie Clowns ... Ihr Interesse galt den Frauen."
Man kann schon jetzt auf die folgenden Teile dieser autobiographischen Trilogie gespannt sein. Sie werden den Partisanen- und Bürgerkrieg und die kommunistische Tito-Zeit aus der Sicht des Heranwachsenden zeigen. Dessen unbestechlicher Blick und seine ausgreifende Phantasie werden ihn gewiß nicht verlassen.
REINHARD LAUER
Lojze Kovacic: "Die Zugereisten". Eine Chronik. Erstes Buch. Aus dem Slowenischen übersetzt von Klaus Detlef Olof. DRAVA Verlag, Klagenfurt/Celovec 2004. 319 S., geb., 23,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Mit "Die Zugereisten" beschließt der slowenische Schriftsteller Lojze Kovacic seine autobiografische Trilogie auf beeindruckende Weise, befindet ein absolut begeisterter Rezensent Andreas Breitenstein. Der vorliegende, dritte Band der Familiengeschichte setzt ein mit dem Abzug der deutschen Truppen aus Slowenien, verfolgt die Begründung des jugoslawischen Staates und dessen totalitäre Entwicklung. Kovacics Schwerpunkt, so der Rezensent, verlagert sich von der in den vorangegangenen Bänden vorherrschenden "Dramatik" der Ereignisse hin zur Reflektion, die vom "Anspruch auf Zeugenschaft" getragen wird. Kovacics packende Schilderung seiner selbst als seiner Umgebung unangepassten und daher ständig "zwischen Ich und Wir hin- und hergerissenen" Knaben liefert einen überzeugenden Beleg dafür, dass "Menschenleben der Mode unterworfen" sind, so das Fazit des rundum zufriedenen Rezensenten.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH