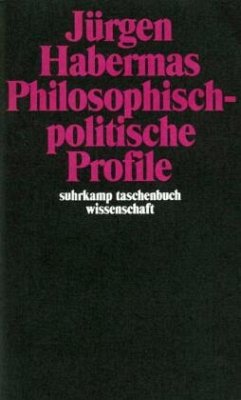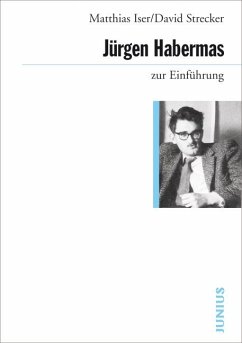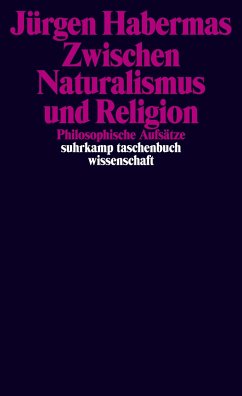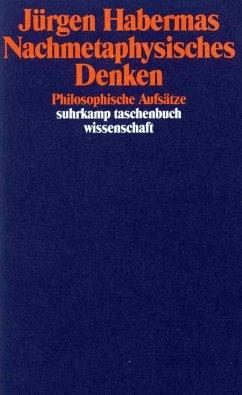Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
17,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Nach wie vor wird die Debatte über die Gentechnik und ihre Folgen lebhaft geführt. In seinem Buch Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? bezieht Jürgen Habermas dezidiert Stellung. Er führt die philosophische Auseinandersetzung über den Umgang mit Genforschung und Gentechnik vom weltanschaulichen Streit über den moralischen Status des vorpersonalen menschlichen Lebens weg und nimmt die Perspektive einer künftigen Gegenwart ein - einer Gegenwart, aus der wir vielleicht auf die heute umstrittenen Praktiken als Schrittmacher einer liberalen, über Angeb...
Nach wie vor wird die Debatte über die Gentechnik und ihre Folgen lebhaft geführt. In seinem Buch Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? bezieht Jürgen Habermas dezidiert Stellung. Er führt die philosophische Auseinandersetzung über den Umgang mit Genforschung und Gentechnik vom weltanschaulichen Streit über den moralischen Status des vorpersonalen menschlichen Lebens weg und nimmt die Perspektive einer künftigen Gegenwart ein - einer Gegenwart, aus der wir vielleicht auf die heute umstrittenen Praktiken als Schrittmacher einer liberalen, über Angebot und Nachfrage geregelten Eugenik zurückblicken.